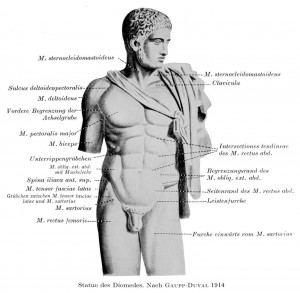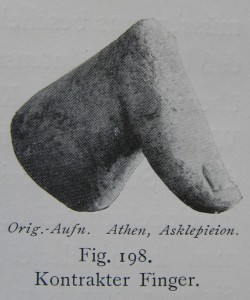Waltrud Wamser-Krasznai Dr. med. Dr. phil.
-
Trivial oder geistvoll?
Joseph Viktor von Scheffel (1826-1886)
Wie kommt eine Orthopädin, die auf ihre alten Tage das Steckenpferd der Klassischen Archäologie reitet, dazu, einen verstaubten Poeten des 19. Jahrhunderts aus der Versenkung zu holen? Nun, meine mütterliche Linie hat badische Wurzeln, und zu den Bibliotheksbeständen dieser Familie gehörte allemal eine Scheffel-Ausgabe. „Der Trompeter von Säckingen“ und „Ekkehard“ waren Standard, und die Lieder aus dem „Gaudeamus“ wurden zur Erheiterung gesungen, wenn ungeistige Arbeiten wie Geschirrspülen auf der Tagesordnung standen. Mein Vater, Naturwissenschaftler, hatte seine Freude an Gedichten wie dem Megatherium oder dem letzten Ichthyosaurus, vom Granit oder vom Asphalt, aus dem hier eine Kostprobe folgt:
Bestreuet die Häupter mit Asche,
Verhaltet die Nasen euch bang,
Heut gibt’s bei trübfließender Flasche
Einen bituminösen Gesang.Schwül strahlet die Sonne der Wüste,
Am Toten Meere macht’s warm;
Ein Derwisch spaziert an der Küste,
Eine Maid aus Engeddi am Arm. […]Zwei schwarzbraune Klumpen lagen
Am Ufer faulbrenzlig und schwer;
Drauf satzte mit stillem Behagen
Das Paar sich und liebte sich sehr.Doch wehe! sie saßen auf Naphtha,
Und das lässt keinen mehr weg,
Wer harmlos sich dreinsetzt, der haft’t da
Und steckt im gediegensten Pech. […]
Umsonst hat ihr Klagen und Weinen
Die schweigende Wüste durchhallt,
Sie mussten zu Mumien versteinen
Und wurden, ach, selbst zu Asphalt. […]So geht’s, wenn ein Derwisch will minnen
Und hat das Terrain nicht erkannt…
O Jüngling, fleuch eiligst von hinnen,
Wo Erdpech entquillet dem Land. (Panzer 1, 25 f.)Während meines Studiums in Freiburg erstand ich antiquarisch eine vierbändige Ausgabe der Scheffel’schen Werke[1]. Seither sind die Reisebilder und Episteln daraus mein Brevier[2]. Eine Fahrt auf Scheffels Spuren im Sommer 2016 mit Kollegen von der Ärztekammer Nordbaden und der Karlsruher Sektion deutschsprachiger Schriftsteller-Ärzte tat ein Übriges.
Der folgende höchst subjektive Beitrag setzt die Schwerpunkte ganz nach meinem persönlichen Ermessen.
Inhalt
1. Gefeiert und geschmäht[3]
2. Leben und Werk des Joseph Viktor Scheffel
3. Nur ein Sauf-Poet?
4. Scheffels Krankheiten
5. Scheffel und die Theorie von der transalpinen Einwanderung der Etrusker
6. Trivial oder geistvoll?
7. „Bestreuet die Häupter mit Asche…“1. Gefeiert und geschmäht
Im Gegensatz zu dem großen Erfolg und der Verehrung, die Scheffel im 19. Jahrhundert und noch in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts zuteilwurden, ist er heute wenigstens nördlich der Mainlinie vollkommen unbekannt. Nur – was heißt das schon? Kaum 20 Jahre sind vergangen seit Friedrich Schiller im gymnasialen Deutschunterricht nicht einmal erwähnt wurde, und das nachdem seine Dichtungen in der Gunst des Publikums zeitweise höher standen als diejenigen Goethes. Doch vergleichen wir nichts Unvergleichliches!
Scheffel ist frühzeitig diffamiert worden. Schon 1884 schrieb Gustav Mahler: „Ich habe eine Musik zum Trompeter von Säkkingen komponieren müssen…“. Es „hat … nicht viel mit Scheffelscher Affektiertheit gemein.“ Die Partitur ist heute verschollen. Mahlers anfängliche Freude an seiner Komposition war offenbar „bald einer Verdrossenheit darüber gewichen“[4]. Das war noch zu Scheffels Lebzeiten, als sich Gaudeamus, Trompeter und Ekkehard gerade gut zu verkaufen begannen[5]. Während des 20. Jahrhunderts aber gossen Kritiker und Rezensenten eine solche Flut von Diskreditierung und „Verdrängung“ über den Verfasser aus[6], dass nur einiges Wenige davon genannt werden kann: „Viktor von Scheffel, eine fränkische Fehlanzeige“[7], Trivialliteratur[8], Simmel des 19. Jahrhunderts, billiger „Kitschier“[9], dessen „literarischer Rang unbestritten zweifelhaft ist“[10]. Sein Humor täusche eine dichterische Kraft vor, die er nur in geringem Maße besaß und „früh verlor“. Er sei ein Repräsentant für …“den Verfall der geselligen Lyrik zum billigen Bierkneipenton“[11].
Wer sich nun trotzdem nicht an der Beschäftigung mit Scheffels Werk hindern lässt, folgt am besten Mahals Empfehlung[12] und nimmt sich die Briefe und Reisebilder vor[13]. Scheffel besaß selbst „ein gerüttelt Maß an Selbstironie“ und war dadurch vor dichterischer Überheblichkeit gefeit[14]. Also können wir nichts Besseres tun, als ihn möglichst oft selbst sprechen zu lassen:
„Wenn du mir den Gefallen tust, die von mir handschriftlich vorhandenen Dichtungen … zu verbrennen, so bleibt mir auch kein Wunsch mehr übrig…Da ich vieles geschaffen, was schöner ist, so geht der Stoff nicht aus, wenn auch das alte Zeug in Lethe versenkt wird“[15].
Ein Tag am Quell von Vaucluse: „Ich … verfertigte ein wohlgedrechseltes Sonett … verschloss es in eine … Flasche … und warf Flasche und Sonett in die Tiefe der Flut…Da ich aber bei dieser Gelegenheit, den Widerhall der Felswände zu prüfen, mit starker Stimme: Petrark! Petrark! rief, klang leise gehaucht ein … Arg! Arg! zurück, sodass ich von jeder weiteren Behelligung des Echo sofort abstand“[16].
Zu einigen Gedichten allerdings fällt auch mir auch nichts anderes ein als „arg“. Es folgen Auszüge von den Ärgsten:
Pumpus von Perusia.
Ein mildes Kopfweh, erst der jüngsten Nacht entstammt,
Durchsäuselte die Luft mit mattem Flügelschlag…
O Fufluns, Fufluns! unheilvoller Bacchus du!
s’ist alles fort und hin und hin und fort…hahumm!…
Ich – Pumpus von Perusia, der Etruskerfürst!…
Doch jenen Tages ward im Wald bei Suessulae
Zum erstenmal, seit dass die Welt erschaffen stand,
Ein Held von einem andern Helden – angepumpt!
Das ist der Sang vom Pumpus von Perusia.(Panzer 1, 32-34)
Nicht nur arg, sondern dreimal autsch! Dieses Elaborat ist noch dazu endlos lang.
Oder:
Rodensteins Auszug.
Es regt sich was im Odenwald – Rum plum plum… (Panzer 1, 290)
Die Zechlieder zeigen wie Scheffel „auf dem schmalen Grat zwischen philologischer Genauigkeit und hausbackener Verfremdung mit seinen Gegenständen umzugehen wusste“, konstatiert Rüdiger Krohn[17], und fährt dann fort: Das ist seine Tragik: „Dass er sich […] im Widerspruch von Kunst und Unterhaltung selbst abhanden kam“.
2. Leben und Werk des Joseph Viktor Scheffel[18]
Er ist 1826 in Karlsruhe geboren und 60 Jahre später auch dort gestorben. Sein Vater, Philipp Jakob, war als Ingenieur und Offizier in der Wasser- und Straßenbaudirektion tätig und mit der Korrektur und Überwachung des Rheinlaufs zwischen Basel und Mannheim betraut. Seinem pflichttreuen, ein wenig starren und pedantischen Charakter kam eine regelmäßige bürgerliche Laufbahn entgegen. Kein Wunder, dass er der unsicheren Lebensbahn seines Sohnes zweifelnd gegenüberstand. Was Joseph Viktor zum Dichter machte, verdankte er der Mutter, die heiteren Sinnes und eine gute Erzählerin war. Ihre Märchen erfand sie selbst, schmiedete Verse mit großer Leichtigkeit und schrieb Dramen, darunter eines in ihrer badischen Mundart. Die Großmutter mütterlicherseits stammte aus Rielasingen am Hohentwiel und machte den Enkel schon früh mit dem Ekkehard und dessen Schauplatz vertraut[19].
Im Karlsruher Gymnasium erhält Scheffel eine gründliche Ausbildung in den klassischen Sprachen, studiert dann aber Jura auf Wunsch seines Vaters, der für den Sohn eine solide Beamtenlaufbahn anstrebt. Gleich in den ersten Semestern in München geht Joseph neben der Rechtsgelehrsamkeit seinen künstlerischen Neigungen nach. Er hört Ästhetik, Kunstgeschichte und Philosophie und lernt Kaulbach und Moritz von Schwind kennen. In Heidelberg liegt der Schwerpunkt dann, von der Jurisprudenz abgesehen, auf der Literatur. Als Mitglied studentischer Vereinigungen wirkt er an der relativ fortschrittlichen Verfassung einer Burschenschaft mit. Zahlreiche Männerfreundschaften glücken ihm besser als seine Versuche auf dem Felde der Frauenliebe, wo er ein Missgeschick nach dem anderen erleidet. Unsterblich und schicksalhaft verliebt er sich in seine Base Emma. Obwohl Vetter und Cousine jeweils Ehen mit anderen Partnern eingehen, stehen sie zeitlebens in enger Verbindung und treffen sich immer wieder, was vor allem Scheffels Ehe nicht gut bekommt. Schon vor der Geburt des gemeinsamen Kindes trennt sich die Gattin Caroline von Malsen von ihm, und eine Versöhnung kommt erst wieder an Scheffels Sterbebett zustande. Der Sohn, ebenfalls Viktor, wird seinem Vater von der Mutter vorenthalten, bis jener den Jungen eines Tages aus München entführt. Nach einem recht glücklichen Zusammenleben der beiden Männer schlägt der Junior die militärische Laufbahn ein.
Zurück zum Studium. Man schreibt das Jahr 1848. Scheffel ist nicht unpolitisch. Er beteiligt sich als zweiter Sekretär des badischen Bundestagsgesandten an den Verhandlungen des Vorparlaments in Frankfurt und nimmt am Burschenschafter-Fest auf der Wartburg teil. Gleichwohl besteht er ohne größere Mühe das Staatsexamen. Die Enttäuschung über die geringen Erfolge der bürgerlichen Revolution haben ihm die politische Tätigkeit verleidet. Er schreibt: „Ich wollt‘, ich könnt‘ eher heut als morgen…auf italischem Boden einen Schluck Lethe trinken, in dem alle Erinnerungen seit 1848 ausgetilgt würden“[20]. Er tritt in eine juristische Praxis in Heidelberg ein. Anfang 1849 wird er summa cum laude zum Dr. jur. promoviert. Die beiden Jahre, die er anschließend in Säckingen als Rechtspraktikant verbringt, sowie ein paar Monate am Hofgericht in Bruchsal sind beinahe das letzte Zugeständnis an eine Beamtenlaufbahn, die er alsbald aufgibt. Seine Bewerbung um die vom eidgenössischen Polytechnikum in Zürich ausgeschriebene Professorenstelle für deutsche Literatur bleibt begreiflicherweise neben der des qualifizierten Literaturwissenschaftlers und Philosophen Friedrich Theodor Vischer erfolglos[21]. Besorgt erkennt Scheffels Mutter seine „inneren kranken Seelenzustände …nach dergleichen Enttäuschungen, Überfülle von Wissensdrang und Phantasie – neben einer unbeschreiblichen Unkenntnis des wirklichen Lebens“[22]. Im Alter von 26 Jahren, 1852, lässt Scheffel das bürgerliche Dasein endgültig hinter sich.
Mein Hutschmuck die Rose,
Mein Lager im Moose,
Der Himmel mein Zelt:
Mag lauern und trauern,
Wer will, hinter Mauern,
Ich fahr‘ in die Welt!
(Panzer 1, 81, Strophe 3)Wieder einmal erlebt ein deutscher Bildungsreisender in Italien, dass er eher zum Dichter als zum Maler berufen ist. Die Mutter, die ihn besser kennt als er sich selbst, schreibt: „In Rom will er malen! – Was sagen Sie dazu?! Ich meine, sein ihm von der Natur gegebener Pinsel sei die Feder. Was er mit der Feder malte, war immer das Beste und – ich denke, in Rom wird ihm das schon klar werden.“[23]
Seine Vers-Dichtung „Der Trompeter von Säckingen“ und der Roman „Ekkehard“[24] liegen bereits 1854 und 1855 vor, beruhigen den Vater jedoch keineswegs über die Zukunft des Sohnes. Die Mutter dagegen akzeptiert, dass er als Künstler zu leben versucht, „Kunst und Poesie spuken zu gewaltig in ihm. In Gottes Namen! – er ist jetzt Mann und wird wissen, was er zu tun hat…“[25]. Die Reisebilder und Episteln sind voll scharfsinniger Beobachtungen und schnurriger Kommentare, sprühen von geistvollen Vergleichen und ironischen Anmerkungen. Er schildert das Ambiente des Säckinger Gasthauses „Zum goldenen Knopf „, alemannisch der „Chnopf“[26], sowie das Wirtshaus „Zum dürren Ast“ im Hauensteiner Schwarzwald[27]. Dessen Name gefällt ihm so, dass er sich, wenn er bei Laune ist, danach benennt: „Josephus vom dürren Aste“[28].
Doch Scheffel ist durchaus nicht immer bei Laune. Im Gegensatz zu den heiteren Säckinger Episteln schlagen in den sachlichen Briefen oft Missmut und Resignation durch: „Im einförmigen Geschäftsleben vergeht ein Tag wie der andere, u. die Pointe des Tags besteht darin, dass man Abends viel Bier trinkt!“[29]
Manches misslingt; er ist unstet, zögerlich, inkonsequent und neigt zur Melancholie. Von einem hartnäckigen Augenübel[30] ist die Rede, und er leidet an fieberhaften Zusammenbrüchen. Einen furchtbaren Schlag bedeutet der Tod seiner Schwester Marie, die 1857 an Typhus stirbt.
Bürgerliche Stellungen werden gar nicht erst angetreten[31]. Obwohl ihn Karl Alexander von Sachsen-Weimar-Eisenach fördert und ihn sogar auf der Wartburg wohnen lassen will, kommt der geplante Wartburg-Roman nicht zustande. Der Großherzog hatte sich zu der erfolgreichen malerischen Ausgestaltung der Burg durch Moritz von Schwind von Scheffel ein literarisches Gegenstück gewünscht. Doch fehlen ihm „…für sein Vorhaben sowohl die aesthetische Kreativität als auch die wissenschaftliche Kompetenz und Methode, um seine vielen Ideen und Einfälle planvoll zu ordnen, kritisch auszuwerten“[32]. Seine hellsichtige Mutter schreibt: „Was Joseph vor Weimar so scheu macht, ist der Gedanke an die großen Geister – Goethe, Schiller, Herder – in solche Fußstapfen treten zu sollen, erscheint seiner Bescheidenheit ein vermessenes Wagstück. Er fürchtet, ein zu schwaches Reis am alten großen Dichterbaum zu werden.“[33]
Das Amt des Hofbibliothekars in Donaueschingen, zu dem Scheffel vom Fürsten von Fürstenberg berufen wird, gibt er nach einem Jahr bereits wieder auf. Zum 50. Geburtstag, 1876, wird Scheffel der erbliche Adelstitel verliehen. Die Gabelbach-Gemeinde[34] zu Füßen des Kickelhahns, an deren Versammlungen er mehrfach teilnimmt, ernennt ihn zum Ehrenbürger und Gemeindepoeten. Leider erlebt er die Einweihung des Scheffeldenkmals und anderer nach ihm benannter Plätze nicht mehr. Ohnehin stehen die zum Teil posthum verliehenen Ehren gerade am Kickelhahn im Schatten eines weit Größeren, dessen weltberühmtes Gedicht „Über allen Gipfeln ist Ruh“ dort entstand.
3. Nur ein Sauf-Poet?[35]
Die bevorstehende Herausgabe der Liedersammlung „Gaudeamus“, zu der Scheffel sich nur unter erheblichen Bedenken entschließt[36], lässt ihn mit Recht befürchten, als „Sauf-Poet“ apostrophiert zu werden, eine Bezeichnung, die sich alsbald zum „geflügelten Wort“ aufschwingt[37]. Blättert man den „Gaudeamus“ auf entsprechende Hinweise durch, so stellt man je nach Veranlagung mit Hochachtung oder Indignation fest, dass in 32 von 52 Liedern von Durst, Trinken, Trunkenheit, Wein, Bier oder Wirtshaus, die Rede ist[38]. Das plastische Wort „Trinkung“ stammt ebenfalls aus Scheffels Schöpferwerkstatt:
„Von eygentlicher Trinkung ist in Florenz nichts vorgefallen…bin somit darauf eingeschränket gewesen, mit dem Küster der alten, merkwürdigen Kirch‘ San Miniato eynes Abends etzliche Korbflaschen auszustechen, so schier bis gen Mitternacht gewähret.“ (Römische Epistel Caput I, Panzer 4 , 310 f.)
oder:
„Und war dies die schärfste Trinkung, so ich seit meiner Abfahrt aus Deutschland erlebet – hab‘ mich aber tapfer durchgefochten…“ (Caput VI, Panzer 4, 331).
oder:
„und begann von neuem an meinen guten Stern zu glauben, der mich ohne Vorbedacht …schon so manchem Frühstück und anderweiter Trinkung entgegengeführt…“ (Brief aus Venedig, Panzer 4, 367)
oder:
„wie die erst‘ Ausruhung und Atzung vorüber war, entspann sich eyne gelinde, aber ausdauernde Trinkung, und brachte die preiswürdige Regina eyne schwere Pfann‘ vino caldo, dessen Zubereitung… der alte Meister Willers von Oldenburg[39] kunstreich gelehret“ (Römische Epistel 6, Panzer 4, 343).
Ein Lied, das früher in jedem Kommersbuch stand, ist in den „Trompeter von Säckingen“ integriert (Panzer 2, 212 f.):
Alt Heidelberg, du feine…“
Auch hier heißt es:
Stadt fröhlicher Gesellen,
An Weisheit schwer und Wein,..Nicht von Scheffel dagegen stammt, wie gelegentlich behauptet wird, das Kommerslied „Gaudeamus igitur“. Er hat es natürlich gekannt und seine berühmteste Liedersammlung danach betitelt: „Gaudeamus“.
In den Reisebildern „Aus dem Hauensteiner Schwarzwald“ geht es ebenfalls alkoholisch zu:
„So war im Wirtshaus zum dürren Ast der Wein so wehmütig zusammenschnürend, dass einem minder starken Charakter die Versuchung zum Schnaps sehr nahegelegt war“. „G’soffe muss doch sy!“ (Panzer 4, 73 f.).
Kein Wunder, dass Scheffel sich für den persischen Dichter Hafis interessiert, der im 14. Jahrhundert Lieder von Wein und Weib, von Schenken und schönen Knaben[40] verfasste. Durch den Divan des Hafis war Goethe bekanntlich zu seinem West-Östlichen Divan angeregt worden.
Hafis: Der Buchstabe Dal XCVIII
…Mein Herz, wenn du die Lust
Von heut auf morgen stets verschiebst,
Für das geborgte Gut,
Wer wird Gewährsmann sein?
Gib in dem Mond Schaban
Den Becher nimmer aus der Hand…[41]1852 entsteht Anselm Feuerbachs Bild „Hafis vor der Schenke“. Der Maler lebt zu dieser Zeit in Karlsruhe und begleitet Joseph Viktor auf seiner Reise nach Venedig und zum Kastell Toblino[42].
„Sein damalig Wald-und Feldbrevier…oder besser der fahrenden Schüler lateinisches Liederbuch“[43] waren die Trink- und Vagantenlieder der Carmina Burana. Meum est propositum in taberna mori… Mein Geschick ist’s, in der Kneipe zu sterben[44] – nun, dazu ist es dann doch nicht ganz gekommen…
4. Scheffels Krankheiten:
In der Kenntnis feucht-fröhlicher Reime und kontemplativer Trinkungen[45], sowie der Tatsache, dass Scheffel aus heutiger Sicht „nur“ 60 Jahre alt geworden ist, liegt es nahe, bei den Krankheits-und Todesursachen auch an die Folgen von Alkoholismus und Leberzirrhose zu denken.
In seiner 1907 erschienenen Schrift „Über Scheffels Krankheit“ behandelt P. J. Möbius[46] dessen Konsum geistiger Getränke eher nebensächlich:
„War der Alkoholismus … nicht Ursache der Geisteskrankheit, so dürfte er doch die frühzeitige Erkrankung der Blutgefäße gefördert und dadurch Scheffels Leben abgekürzt haben“[47].
„Wahr ist ja, dass unser Freund, nachdem sich seine Krankheit entwickelt hatte, mehr Wein und Bier zu sich nahm, als ihm gut war, und darin in späteren Jahren Trost und Vergessenheit suchte“[48]. Es scheint aber in Wirklichkeit „nicht so schlimm gewesen zu sein … Scheffels Verherrlichung des Suffes ist wohl eine Art von Sport gewesen.“ Möbius schreibt weiter:
„Ein von Hause aus nervöser junger Mann erkrankt…mit 27 Jahren an Congestionen [lokalem Blutandrang] und heftigen Kopfschmerzen, so dass er für Monate unfähig zur Arbeit wird. Nach zwei Jahren … tiefe Verstimmung, Menschenscheu, wahrscheinlich auch Wahnvorstellungen. Es zeigt sich, dass der Kranke dauernd geschädigt ist, dass seine Schaffenskraft mehr und mehr erlischt … zeitweise Erregung und Depression, zeitweise heitere Stimmung und Fähigkeit zu arbeiten…Im 35. Lebensjahre schwerste Erkrankung, Verfolgungswahn“, Schuldgefühle. Langsame Rekonvaleszenz, „die dichterische Leistungsfähigkeit sinkt immer mehr … Mit 42 Jahren Beginn der Erkrankung des Herzens und der Pulsadern [Atheromatose]…Mit 60 Jahren Tod.
„Die Diagnose kann … nicht zweifelhaft sein: leichte Form des zerstörenden Jugendirreseins, der sogenannten Dementia praecox [veraltete Bezeichnung für Krankheiten aus dem Formenkreis der Schizophrenie]…“.
Möbius sammelt Argumente für eine erbliche Geisteskrankheit in der Familie Scheffel. Joseph Victor hatte einen geistig und körperlich schwer behinderten jüngeren Bruder, der immerhin 53 Jahre alt wurde. Nach dem Tod des verwitweten Vaters betreut der Ältere den Bruder eine Zeitlang allein. In Marie, der von allen geliebten, als schön, geistvoll und liebenswürdig[49] beschriebenen Schwester, war „das Pathologische nicht gering“, als sie „1853 ihre Verlobung unmittelbar vor der Hochzeit, als schon die Kleider bereit lagen, auflöste“[50], sic!
Scheffel selbst war „nach knapp 10 Jahren“ von seiner Krankheit zwar „geheilt, aber … seine Dichterkraft war zerstört“[51].
Wir versuchen einmal, aus den am häufigsten erwähnten krankhaften Störungen eigene Verdachtsdiagnosen abzuleiten[52] (jeweils in Kursivschrift).
Scheffel fühlt sich „unbeschreiblich bedrückt“, nachdem die republikanische Zukunft des Landes im April 1848 „verpfuscht“ erschien[53]. „Meine Komik ist oft nur die umgekehrte Form der inneren Melancholie“[54]. Als Marie ihre Verlobung löst, reagiert die ganze Familie mit einer aus heutiger Sicht völlig übertriebenen Aufregung[55]. Tiefe Erschütterung nach dem Tod der Schwester. Hypochondrie. Als Brautwerber mehrfach abgewiesen[56]. Selbstquälerei um den unbewältigten Wartburg-Roman, krankhaftes Misstrauen, da er eine geänderte negative Einstellung des Weimarer Großherzogs, den er enttäuscht hatte, befürchtet[57] (reaktive Depression).
„Kopf-Kongestionen“, Augenleiden, „Gehirnentzündung“, Blutkongestion nach dem Kopf, Augenentzündung, Nervenreiz[58]…“mein ganzes Nervenleben ist durch die übertriebene Arbeit am Ekkehard zerrüttet…“ (Burnout-Syndrom[59]).
Kopfschmerz, Gesichtsschmerzen, auch die Mutter litt zeitweise daran
(Migräne mit Aura, Einschränkung des Gesichtsfeldes und andere visuelle Phänomene. Trigeminusneuralgie).
Wechselfieber. Reise nach Südfrankreich; in Bordighera hoch fieberhafte Attacken, die sich auch in Deutschland noch fortsetzen[60]. Gedicht „Dem Tode nah“[61] (Malaria).
Herz-Kreislaufsymptome, „Druck am Herzen“. Lähmung der linken Seite, Besserung nach Kur in Bad Kissingen, Gefahr …stärkeren Schlaganfalles, Brustschmerzen, Atemnot[62] (Arteriosklerose, Angina pectoris, Apoplexie).
Lassen wir die Diagnosen „Dementia praecox“ und „Geisteskrankheit“ getrost außer Acht und sprechen stattdessen von depressiver Verstimmung, reaktiver Depression, Melancholie. Dass Scheffel als Heiratskandidat Körbe einsammelt und von seiner schwangeren Frau noch vor der Entbindung verlassen wird, auch dass Marie ihre Hochzeit absagt, all dies spricht weniger für eine familiäre Geisteskrankheit als für mangelhafte Bindungsfähigkeit der Geschwister.
Die Versuche, Scheffels beeindruckenden Alkoholkonsum herunterzuspielen und zu verharmlosen, sind rührend[63], aber nicht ganz überzeugend. So heißt es gleich im Vorwort zur ersten römischen Epistel:
„Inzwischen ist viel Wasser den Rhein ab, – auch viel Weines halsabwärts geflossen…“.
Als Scheffel im Café Greco in Rom eine „epistola encyclica“ der Freunde aus dem Heidelberger „Engeren“ in Empfang genommen und „un fiasco d’Orvieto“ dazu bestellt und „still gerührt getrunken“ hat, versucht er es mit einer scherzhaften Rechtfertigung, dass nämlich „in der zehrenden Hitz‘ und dem scirocco Welschlands eyne innere Ursach‘ liegt, dass der deutsche Mensch allhiero sträflich viel Weines tilgt…und eyn leiser Anflug von südlicher Färbung auf der Nase mag…eher zu den ‚wunderbaren Lufterscheinungen bei Sonnenauf-und Untergang‘ in der Umgegend Roms als zu eynem testimonium allzu scharfer Trinkung zu zählen sein.“
In der 6. Römischen Epistel[64] berichtet er:
….“Und hat der Wirt eyn ungeheures pranzo hergerichtet – und haben die Italiener den alten Brauch, beim convivium zwischen jeder Schüssel eyns zu singen – und sangen auch – aber sehr unflätiger Lieder – und erhub sich eyn scharfes Trinken, … dass etzliche, sowohl deutscher als italienischer Nation, unter den Tisch zu liegen kamen. Und hab‘ ich mich damals an der Seit‘ des wackern Meister Willers mannhaft gehalten, – und da selbiger bei solcher occasion gewöhnlich an eynem gewissen ,Nachdurst‘ zu leiden hat, so sind wir wie alte Recken auf der Totenwach gesessen,…und haben miteynand die letzt Flaschen getrunken, als kein Welscher mehr Bescheid tun wollte.“
Das klingt nicht so, als ob Scheffel „die eigenen Trinkleistungen maßlos“ überzeichnete oder sie nur wie „eine Art von Sport“ betrieb[65]!
Doch nun noch zu einem anderen Thema, nämlich der Beschäftigung des Dichters mit den Etruskern und ihrer Herkunft.
5. Die Etrusker und die Theorie von der transalpinen Einwanderung:
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts hatten Aufsehen erregende Entdeckungen und Grabungen auf der Apenninenhalbinsel eine wahre Etruskomanie zur Folge[66]. Von den drei Haupt-Theorien zur Herkunft dieses Volkes favorisiert Scheffel die Einwanderung der Etrusker aus dem Norden[67].
„Item am dritten Tag sind wir…in Perugia eyngefahren, so eyne merkwürdige Stadt ist und guten Rotwein hat. Verfügte mich sofort nach dem Frühtrunk in das etruskische Museum und hab‘ dort…eyn kolossalen sarcophagum angeschauet…Ist auf demselben eyne Emigration des ganzen etruskischen Stammes dargestellt…und ziehen König und Priester, Weib und Kind, Gefangene und Stiere – alle fort, ’nix wie naus‘ – und ward mir sofort klar, dass dies eyn Denkmal des Auszugs nach Graubünden sey…Hab auch eynigen professoribus der Akademie von Perugia dies exponieret, so aber … mir kein Glauben schenkten. Mir aber hat die Sach‘ umso mehr geschienen, als auch die alten Städt‘ der Etrusker, insbesondere Cortona und Perugia mit ihren Cyclopenmauern ganz so auf Bergabhängen daliegen wie die Flecken im Unter-Engadeyn, und behalt‘ mir vor, hierüber meinem lieben Begleiter auf rätischen Fahrten Näheres mitzuteilen…“ (Römische Epistel 2, Panzer 4, 317).
„Wir marschierten … dem Davoser Landwasser entlang…nach Dorf Alveneu. Der Ortsname „Alba Nova“ erinnert, dass wir schon in den Regionen angelangt sind, wo etruskische Einwanderer, einst aus Furcht vor dem Gallier oder Hannibals Scharen…sich eine zweite Heimat gründeten…Engadein, das klassische Etruskertal…“ (Aus den Rätischen Alpen, Panzer 4, 28)
Im Übrigen erfährt Scheffel unterwegs, „dass in Urbino und ganz Umbrien eyn etwas leichtfertiger Gedanke ‚un pensiero etrusco‘ geschimpft wird, …woraus ich auf die alte Geschichte derer Etrusker und ihr Verhältnis zu ihren anderweyten italischen Nachbarn und Nachbarinnen belehrende Schlüsse zog.“ (Römische Epistel 2, Panzer 4, 315).
Einige römische Schriftsteller meinten, dass die Räter eigentlich Etrusker seien, die sich unter der Bedrohung durch die Kelteneinfälle seit etwa 400 v. Chr. ins Gebirge zurückgezogen hätten (Liv. 5, 33, 11; Plin. n. 3, 24). Als Beweis diente allerdings nicht zuletzt, dass selbst für Livius…die Sprache der Räter ähnlich unverständlich war wie das Etruskische. Zudem „ging die Wildheit der Gegend auf sie über und ließ von allem Vererbten nichts übrig als den Klang der Sprache, und den noch nicht einmal rein“. Ob jedoch überhaupt eine Verwandtschaft zwischen den Sprachen der Etrusker und der Stämme in den Zentralalpen bestand, sei nach wie vor ungeklärt[68].
6. Trivial oder geistvoll?
Dies ist die Titel-Frage. In der Tat sind wir auf Triviales gestoßen, auf gereimtes Wort-Geklingel ohne tieferen Sinn, das der Verfasser selbst besser „in Lethe“ versenkt hätte[69]. Gleichwohl fühlen wir uns berechtigt, die Angelegenheit etwas differenzierter zu betrachten, indem wir, entsprechend der Mahal’schen Anregung, den Meister Josephus lieber selbst zu Wort kommen lassen. Genieße wer kann den Reiz der spezifisch Scheffel’schen Ironie, seine Reimfreude und Wanderlust und seine für die Autorin dieses Elaborats einfach unwiderstehliche archaisierende Sprache:
Aus Ekkehard Kap. 16, Cappan wird verheiratet:
„In Hof und Garten schaltete dazumal eine Maid, die hieß Friderun und war hoch wie ein Gebäu von mehreren Stockwerken, drauf ein spitzes Dach sitzt, denn ihr Haupt hatte die Gestalt einer Birne und glänzte nicht mehr im Schimmer erster Jugend; wenn der breite Mund sich zu Wort oder Gelächter auftat, ragte ein Stockzahn herfür als Markstein gesetzten Alters…– itzt stand ihr Herz verwaist. Große Menschen sind gutmütig und leiden nicht unter den Verheerungen allzu scharfen Denkens. Da lenkte sie ihre Augen auf den Hunnen, der sich einsam im Schlosshof umtrieb, und ihr Gemüt blieb mitleidig an ihm haften wie der funkelnde Tautropfen am Fliegenschwamm…“
Nachdem Frau Hadwig der Eheschließung zugestimmt hat und Cappan von Ekkehard gründlich in der christlichen Lehre unterwiesen und getauft worden ist, treten die Hochzeitsvorbereitungen in ihr entscheidendes Stadium.
„Heilige Mutter von Byzanzium! rief [Praxedis, die griechische Zofe der Herzogin], muss das auch noch aufgesteckt werden? Wenn du mit dem Kopfschmuck einherschreitest, Friderun, werden sie in der Ferne glauben, es sei ein Festungsturm lebendig geworden und wandle zur Trauung. Es muss sein! sprach Friderun. […] Cappan war mühsam zu Tisch gesessen und hielt sich aufrecht an seiner Ehefrau Seite…In den langen Zwischenräumen schuf der Hunne seinen vom Sitzen gequälten Gliedmaßen durch Tanzen Luft…tat sieben wirbelnde Luftsprünge … zum Beschluss ließ er sich vor Frau Hadwig ins Knie fallen … als wollt‘ er den Staub küssen, den ihres Rosses Huf berührt … Die Hegauer … aber schöpften ein Beispiel löblicher Anregung aus dem ungewohnten Tanz … denn aus dem fernen Mittelalter klingt noch die Sage von den ’sieben Sprüng‘ oder dem ‚hunnischen Hupfauf‘, der als Abwechslung vom einförmigen Drehen des Schwäbischen … seit jenen Tagen dort landüblich ward“ (Panzer 3, 265-275).
Der Rechtspraktikant hat in seiner Säckinger Amtsstube polizeiliche Aufgaben wahrzunehmen.
„Polizei und Poesie … beide haben es mit den Abnormitäten des Lebens … zu tun; nur ist die Behandlungsweise etwas verschieden; ein und derselbe Gegenstand kann vom polizeilichen Standpunkte bei Wasser und Brot in den Turm gesteckt und vom dichterischen mit lyrischen Flötentönen verherrlicht werden … Also – was bringt der Gendarm heute für ein ,Subjekt‘? Ach Gott, wie klaffen die Schuhe, wie ungeniert sehen die Zehen durch die Lücken des Schuhs … und was für ein stillvergnügtes Gesicht macht das Subjekt! Was ist sein Verbrechen? ,Zweckloses Umhertreiben!‘ …Wie oft hat sich der Polizeirespizient als fahrender Schüler selber auf das zweckloseste umhergetrieben…Leider muss das Subjekt bei Wasser und Brot in den Turm – die Poesie verhüllt ihr Antlitz und trauert.“ (Aus der 6. Säckinger Epistel, Panzer 4, 254 f.)
Noch heute sind die Betrachtungen des philosophierenden Katers Hiddigeigei beherzigenswert:
Hiddigeigei spricht, der Alte:
Pflück die Früchte eh’ sie platzen.
Wenn die magern Jahre kommen,
saug an der Erinn’rung Tatzen.(Trompeter, Strophe 3 aus Lied 9, 5951-5954, Panzer 2, 356[70]).
Fruchtlos stets ist die Geschichte;
Mögen sehn sie, wie sie’s treiben!
– Hiddigeigeis Lehrgedichte
Werden ungesungen bleiben.(Trompeter, Strophe 6 aus Lied 12, 6003-6006, Panzer 2, 358)
Mögen die Liedersammlungen „Neueres“ und „Aus dem Weiteren“ zum guten Teil aus Gelegenheitsdichtung, langatmigen Festgrüßen, Lobliedern auf Orte, Landschaften und Personen bestehen, in epischer Breite daherkommen und ihren Leser rechtschaffen ermüden, so findet sich doch auch manches Perlchen darin:
Mir ist zum Geleite
In lichtgoldnem Kleide
Frau Sonne bestellt;
Sie wirft meinen Schatten
Auf blumige Matten,
Ich fahr‘ in die Welt.(Panzer 1, 81, Strophe 2)
7. Bestreuet die Häupter mit Asche…
Ja, wir finden beim Meister Josephus durchaus Geistvolles, auch Anmutiges und viel Erheiterndes. Andere Meinungen sind natürlich das gute Recht der Kritiker und Rezensenten. Urteilen diese aber, weil es nun einmal Mode ist, nur nach der abwertenden Sekundärliteratur und in völliger Unkenntnis der Werke selbst, dann geben wir ihnen den einen Rat: „Bestreuet die Häupter mit Asche…“[71]
Fußnoten
[1] Herausgegeben von F. Panzer (Leipzig und Wien 1910).
[2] Juniperus, Panzer 2, 422.
[3] Berschin – Wunderlich 2003.
[4] Wunderlich 2003, 204 f.
[5] Eggert 1971, 164; Mahal 2003, 16.
[6] Selbmann 1982, 11.
[7] J. Lobe, Würzburg 1971, 236. 245, Selbmann a. O. 10 Anm. 13-17.
[8] Eggert 1971, 21 f.
[9] Ein “Prä-Simmel“, Mahal 2003, 14-16. 20.
[10] Eggert 1971, 12; Selbmann 1982, 11.
[11] Martini 41981, 313 f. Dort fälschlich: „Johann“ Viktor von Scheffel!
[12] Mahal 2003, 20.
[13] Selbst wenn die letzteren “nicht ohne Heines Prosa denkbar“ seien,
Martini, 41981, 314.
[14] Mahal a. O. 17.
[15] Panzer 1, 197.
[16] Panzer 4, 149 f.; dazu auch Rupp 2003, 110.
[17]Krohn 2003, 37. S. 40 und Anm. 24.
[18] Panzer 1, 5-70.
[19] Panzer 1, 6 f.
[20] Schmidt-Bergmann 2003, 32.
[21] Panzer 1, 27 f.
[22] In einem Brief an Bernhard von Arnswald, den Kommandanten der Wartburg, Krohn 2003, 45 f.
[23] Schmidt-Bergmann 2003, 32.
[24] Eggert 1971, 64-69. 164-171.
[25] Scheffels Mutter an Schwanitz, Schmidt-Bergmann 2003, 34.
[26] Es floriert noch heute, wenn auch nicht ganz an demselben Ort. Säckinger Epistel 1, Panzer 4, 1917, 215; Trompeter 6. 2416-18 und 2436 f. Panzer 2, 275.
[27] Aus dem Hauensteiner Schwarzwald, Panzer 4, 72-75.
[28] z. B. in der Epistel aus Donaueschingen, Ad fontes Danubii 18. Juli 1858, Panzer 4, 471.
an Friedrich Eggers, Schmidt-Bergmann 2003, 30.
[30] Zollner 1976, 10.
[31] Panzer 1, 27.
[32] Wunderlich, zit. bei Krohn 2003, 47.
[33] Zit. nach J. Proelß, Scheffels Leben und Dichten (Berlin 1887) 507, Selbmann 1982, 55 mit Anm. 55.
[34] Scheffel hat ihr im “Gaudeamus“, Aus dem Weiteren, ein Denkmal gesetzt, Panzer 1, 109 f.; Döring 1999, 97-100.
[35] Dazu Zollner1976, “Mehr als ein Sauf-Poet“.
[36] Wie schade wäre es um sein darin enthaltenes Wanderlied gewesen, das heute als “Frankenhymne“ bezeichnet wird: “Wohlauf, die Luft geht frisch und rein…“
[37] „Das böse Wort des Heidelberger Philosophen Kuno Fischer vom “Saufpoeten in Wasserstiefeln“, Zollner 1976, 10; Mahal 2003, 16; “zum Saufpoeten und drittrangigen Reimeschmied machte ihn…“, M. Krüger-Hundrup zur Ausstellung für Frankenlied-Dichter Scheffel in Bad Staffelstein 2011; H. Seele, Der “Saufpoet“ mit dem Faible für Heidelberg, Heidelberger Geschichtsverein; “Scheffels Saufpoesie“, Möbius 1907, 21. .
[38]Man denke nur an das „Sit vino gloria der „Maulbronner Fuge“, Panzer 1, 43-45.
[39] Deutscher Maler, bei dem Scheffel in Italien Unterricht nahm, Panzer 4, 343.
[40] Dazu auch W. Wamser-Krasznai, Nachwort zu: Die Quellen zum west-östlichen Divan, in: dies., Fließende Grenzen, 2015, 114-117.
[41] Hafis, Der DIVAN. Aus dem Persischen von Joseph von Hammer-Purgstall ND 2007.
[42] Panzer 1, 29.
[43] Vorwort zu Juniperus, Panzer 2, 422.
[44] Archipoeta, Vagantenbeichte, aus Carmen X.
[45] Trompeter 2, 968, Panzer 2, 216.
[46] Möbius 1907, 19 f.
[47] Möbius 1907, 20 f.
[48] Kussmaul, auf Grund eigener Beobachtung, Möbius S. 20f.
[49] Dazu die Siebente Säkkinger Epistel: Myn lieb und frumm Schwesterlin Maria! Panzer 4, 265.
[50] Möbius 1907, 5.
[51] Möbius S. 21.
[52] Die berüchtigten “retrospektiven“ Diagnosen!
[53] Panzer 1, 17, 47; “Schwermut und innere Verödung“, Martini 41981, 314.
[54] Möbius S. 6.
[55] Möbius S. 9.
[56] Möbius S. 13.
[57] Möbius S. 12- 14.
[58] Möbius S. 10.
[59] Falls wir den Mode-Anglismus als ernsthafte Krankheit anerkennen wollen.
[60] Möbius S. 11; aus dem Weiteren, Panzer 1, 32: Miasmen aus dem überschwemmten Rhonetal.
[61] Gaudeamus, Panzer 1, 93.
[62] Möbius S. 18 f.
[63] Möbius S. 21.
[64] Panzer 4, 330 f.
[65] Möbius a. O.
[66] Pallottino 1988, 18.
[67] Torelli 1988, 31; Sprenger – Bartoloni 1977, 9.
[68] Pauli 1992, 726 und Anm. 6; ebenso Gleirscher 1991, 11.21.
[69] Panzer 1, 197.
[70] “Typisch ist die Verharmlosung, die Scheffels ,Hidigeigei‘ gegenüber Hoffmanns ,Kater Murr‘ zeigt,“ Martini 41981, 318.
[71] Scheffel: Asphalt, Panzer 1, 25 f.Abgekürzt zitierte Literatur:
Döring 1999: R. Döring, Die Ilmenauer Promenaden (Ilmenau 1999)
Eggert 1971: H. Eggert, Viktor von Scheffel, in: Studien zur Wirkungsgeschichte des deutschen historischen Romans (Frankfurt am Main 1971) 64-69
Gleirscher 1991: P. Gleirscher, Die Räter (Samedan 1991) 11. 21
Krohn 2003: R. Krohn, Mittelalter hausgemacht. Scheffels Schaffen zwischen Historie und Poesie, in: W. Berschin – W. Wunderlich (Hrsg.), Joseph Victor von Scheffel (1826-1886). Ein deutscher Poet – gefeiert und geschmäht (Ostfildern 2003) 35- 55
Mahal 2003: G. Mahal, Erinnerungen an einen Vergessenen, in Berschin – Wunderlich a. O. 11-21
Martini 41981: F. Martini, Deutsche Literatur im bürgerlichen Realismus 1848-1898 (Stuttgart 41981) 313-318. 446-448
Möbius 1907: P. J. Möbius, Über Scheffels Krankheit. Kritische Bemerkungen über Pathographie (Halle 1907)
Pallottino 1988: M. Pallottino, Etruskologie (Basel – Boston – Berlin 1988)
Panzer: Scheffels Werke. Hrsg. Friedrich Panzer (Leipzig und Wien 1910)
Pauli 1992: L. Pauli, Auf der Suche nach einem Volk. Altes und Neues zur Räterfrage, in: Die Räter – I Reti (Bolzano-Bozen 1992) 725-756
Rupp 2003: M. Rupp, Ein Stück nationaler Geschichte in der Auffassung des Künstlers. Joseph Victor von Scheffel und die Mediävistik, in: Berschin – Wunderlich a. O. 109-134
Scheffels Werke, Hrsg. F. Panzer (Leipzig und Wien1910)
Schmidt-Bergmann 2003: Hansgeorg Schmidt-Bergmann, „mein bester Kern ist immer noch der Zug zur Kunst“. Briefe und Notizbücher Joseph Victor von Scheffels zwischen 1848 und 1853, in: Berschin – Wunderlich a. O. 23-34
Selbmann 1982: R. Selbmann, Dichterberuf im bürgerlichen Zeitalter. Joseph Viktor von Scheffel und seine Literatur (Heidelberg 1982)
Sprenger – Bartoloni 1977: M. Sprenger – G. Bartoloni, Die Etrusker (München 1977)
Torelli 1998: M. Torelli, Die Etrusker (Wiesbaden 1998)
Wunderlich 2003: W. Wunderlich, Scheffels Trompeter von Säckingen und Ekkehard in Oper und Konzert, in: Berschin – Wunderlich a. O. 191-222
Zollner 1976: H. L. Zollner, Mehr als ein Sauf-Poet, in: Aufbruch 12. 6, 1976, 10
Copyright Dr. Dr. Waltrud Wamser-Krasznai
-
Beitrag zur Lesung „Geheimnisse“ bei dem BDSÄ-Kongress in Würzburg 2016
Die Leiden des Philoktet und der Lessing’sche Laokoon
Zu meiner Schulzeit war es in der gymnasialen Mittelstufe noch üblich, am Tag vor Beginn der Ferien an die Tafel zu schreiben:
“Es ist schon immer so gewesen – am letzten Tag wird vorgelesen.”
Unser vorlesender Mitschüler machte das ausgezeichnet, und die Texte, die er zu Gehör brachte, waren unterhaltsam und erheiternd. Eines Tages hörten wir “Der Besuch im Karzer”, eine Humoreske des Gießener Autors Ernst Eckstein. Sie spielt im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts an einem Gießener Gymnasium. Der Direktor, ein jovialer Altphilologe mit besonderen Aussprache-Gepflogenheiten – er verwandelt die hellen Vokale samt und sonders in dunklere – liest mit Schülern der Oberstufe das Sophokles-Drama Philoktet. Der Heros ist mit den anderen Griechen nach Troja aufgebrochen und wird unterwegs von einer Schlange gebissen. Er empfindet den Schmerz als so unerträglich, dass er fortwährend und durchdringend schreit und ihn die Gefährten entnervt auf der Insel Lemnos zurücklassen.
Bild 1: Rotfigurige Bauchlekythos NY ca. 430 v. Chr.
Zum Jubel der Klasse verdeutscht der übersetzende Primaner das Wehgeschrei des Unglücklichen mit ai, ai, ai, ai… “ Da fällt ihm der Direktor in die Rede: Sagen Sä au, au, au, au. Das “ai” als Interjektion des Schmerzes äst sprachwädrig”. Auch den Einwurf „nun, umso besser“ verwandelt die eigentümliche Diktion des Pädagogen in: “non, omso bässer”, natürlich ebenfalls zum Entzücken der Schüler. Ich muss es mir leider versagen, den Fortgang des Unterrichts und seine Folgen mit Ihnen zu genießen; denn wir haben es hier mit einem leidenden griechischen Helden zu tun.
In seiner Abhandlung “Laokoon oder über die Grenzen der Malerei und Poesie” bezeichnet Lessing subsummierend „die bildenden Künste überhaupt” mit dem Begriff Malerei. So stellt er den hemmungslos mit weit aufgerissenem Mund schreienden Philoktet aus der Dichtung dem maßvollen Ausdruck des Schmerzes gegenüber, den die Bildhauer dem trojanischen Priester Laokoon und seinen Söhnen gegeben haben, obwohl alle drei in Kürze der tödlichen Umklammerung durch die gewaltigen Schlangen erliegen werden.
Bild 2: Laokoon, Vatikan
Nach: W.-H. Schuchhardt, Die Kunst der Griechen, 1940, 440 Abb. 410
Entgegen der Behauptung Winckelmanns, Laokoon leide wie der Philoktet des Sophokles, zeigt nun Lessing, dass es den Bildhauern gelang, beim Laokoon “unter den angenommenen Umständen des körperlichen Schmerzes…auf die höchste Schönheit” hin zu arbeiten, wozu allerdings die entstellende Heftigkeit herabgesetzt, “Schreien in Seufzen” gemildert werden musste, “nicht weil das Schreien eine unedle Seele verrät, sondern weil es das Gesicht auf eine ekelhafte Weise” verzerrt. “Man reiße dem Laokoon in Gedanken“ einmal „den Mund auf und urteile”.
Bild 3: Was ist schon Sport ohne Schrei?
Nur eine Darstellung, die “Schönheit und Schmerz zugleich” zeige, könne Mitleid erregen, während der Anblick heftigen Schmerzes allein abscheulich sei und “Unlust erregt, ohne dass die Schönheit des leidenden Gegenstandes diese Unlust in das süße Gefühl des Mitleids verwandeln kann”[1].
Was jedoch den schreienden Philoktet angeht, so ist der überwältigende, fast unangemessene Schmerz nicht das einzige Übel, das ihn befallen hat. Die schlecht heilende Wunde entwickelt nämlich einen widerwärtigen Gestank, den Freunde und Kriegsgefährten nicht ertragen. Dieses in der Sekundärliteratur (z. B. DNP 9, 832 f. RE 1938, 2501[2]) durchweg geradezu genüsslich, manchmal sogar als einziges[3], beschriebene Symptom, spielt offenbar nicht in allen antiken Quellen eine vergleichbare Rolle. Im sog. Schiffskatalog im 2. Gesang der homerischen Ilias ist zwar von Schmerzen die Rede, nicht aber vom üblen Wundgeruch (Il. 2, 714-728). Auch Sophokles lässt Odysseus lediglich mitteilen:
„Ihm fraß am Fuße eine Wunde, eitrig, nässend,
und seine wilden Schmerzensschreie, Jammern, Stöhnen
durchhallten unaufhörlich unser Heer und machten
uns Spenden, Opfer, jeden stillen Gottesdienst
unmöglich.“ (Philoktetes 7-11).Später äußert sich der Betroffene selbst gegen Neoptolemos:
„Du, edel nach Charakter wie nach Abstammung,
mein Junge, fandest standhaft dich mit allem ab,
mit meinen schrillen Schreien, meinem Pestgestank.“ (κακῂ ὀςμῂ).(Philoktetes 874-876).
Die Ausdrucksweise der Weggefährten ist bemerkenswert zurückhaltend. Immerhin geht es um die Verletzungsfolgen eines befreundeten Kommandanten von sieben Schiffen mit Bogenschützen, den die Achäer schnöde vernachlässigen und auf einer unwirtlichen Insel zurücklassen[4]. Wollte Sophokles ein Geheimnis aus dieser unrühmlichen Tatsache machen? Oder hielt er – ein Priester des Heil-Heros Halon und Wegbereiter des Asklepioskultes in Athen, der wohl mit dem Medizinbetrieb einigermaßen vertraut gewesen ist – den Gestank einer eitrigen, nässenden Wunde für so selbstverständlich, dass er ihn nur nebenbei erwähnte? Wir heutigen Ärzte würden das Krankheitsbild als „feuchte infizierte, stinkende Gangrän“[5] bezeichnen. Werfen wir einen kurzen Blick auf andere retrospektive Differentialdiagnosen:
1. Chronoblastomykose, eine Pilzinfektion der Wunde, geht auch bei eingetretener bakterieller Superinfektion gewöhnlich nicht mit derart heftigen Schmerzen einher[6].
2. Gicht erklärt zwar exzessive Schmerzen, nicht aber die purulenten Exsudate[7].
3. Aktinomykose, eine Mischinfektion, häufig durch Bakterien aus der Gruppe der Aktinomyzeten verursacht, führt nicht zu Schmerzen.
4. Osteomyelitis – das Ausmaß der Schmerzen passt nicht dazu[8].
5. Eine Anaerobierinfektion[9] wie Gasbrand hätte, ohne Antibiotika, wohl zu einem fatalen Ende geführt und kommt schon aus diesem Grund kaum in Betracht.
6. Am wahrscheinlichsten ist eine chronische bakterielle Mischinfektion aus Aerobiern bzw. Anaerobiern mit der Folge einer Gangrän.
In der Bibliothek Apollodors, einer vermutlich aus dem 1. Jh. n. Chr. stammenden Mythensammlung (Apollod. Epitome 3, 27), wird der Bezug zwischen Gestank und schmerzhafter Wunde klarer, und auch Hygin erwähnt in seiner Fabelsammlung (Hyg. fab. 102, 2. Jhs. n. Chr.) den ekelerregenden Geruch. Beide berufen sich vermutlich auf ältere, für uns verlorene, Quellen wie den Philoktet des Aischylos oder des Euripides. Wir wissen zwar, dass die gleichnamige Tragödie des Euripides zusammen mit zwei anderen tragischen Stücken und einem Satyrspiel des Dichters an den Dionysien des Jahres 431 v. Chr. aufgeführt wurde, doch ihren Wortlaut kennen wir nicht[10]. Dies gilt auch für den früher entstandenen Philoktet des Aischylos[11]. Jener üble Geruch muss aber früh zum Philoktet-Mythos gehört haben, war er doch ein Argument, mit dem die Griechen ihr unmenschliches Verhalten – die Vernachlässigung eines kranken Gefährten – zu erklären suchten. Dass wir keine archaischen Darstellungen des Ausgesetzten haben, hängt vielleicht mit jenem ’schlechten Gewissen‘ zusammen. Als dann Aischylos und nach ihm Euripides und Sophokles die Tragik des Philoktet als Schicksal darstellten, trat er auch in der Bildkunst auf[12]. Doch während der Kranke in der Sophokles-Tragödie an der Grenze zum Wahnsinn einen regelrechten Schrei-Exzess absolviert[13], zeigen ihn die bisher bekannten bildlichen Darstellungen stets mit einem geschlossenen, allenfalls nur leicht geöffneten Mund[14]. In ihrer dezenten Gestaltung bleiben sie sogar hinter dem maßvollen Ausdruck des Schmerzes zurück, der den Laokoon und seine Söhne kennzeichnet. Eine Wiedergabe ‚in Schönheit‘ siegte in klassischer Zeit allemal über tragischen Realismus[15].
Philoktet aber wird, weil man ihn vor Troja braucht, später aus Lemnos abgeholt und durch die Söhne des Asklepios, Machaon und Podaleirios, von seinem Übel geheilt.
Literatur:
[1]Laokoon. Lessings Werke Band 3 (Stuttgart 1873) 69. 76 f.
[2] Der Neue Pauly; Realezyklopädie der klassischen Altertumswissenschaften; dazu auch M. Grmek – D. Gourevitch, Les maladies dans l’art antique (Paris 1998) 99. 109; E. Simon, Philoktetes – ein kranker Heros, in: H. Cancik (Hrsg.), Geschichte – Tradition – Reflexion. Festschrift für Martin Hengel zum 70. Geburtstag (Tübingen 1996) 16; J. Söring, Das Schreien des Philoktet. Sophokles und Heiner Müller, in: J. Söring – O. Poltera – N. Duplain (Hrsg), Le théâtre antique et sa réception. Hommage à Walter Spoerri (Neuchâtel 1994) 154 f. A. Thomasen, Philoktet – ein Thema mit Variationen, Clio medica 18, 1983, 1.
[3] So P. Blome, Der Mythos in der griechischen Kunst. Der troianische Krieg findet statt, in: Traum und Wirklichkeit Troia (Stuttgart 2001) 144; C. W. Müller, Das Bildprogramm der Silberbecher von Hoby, JdI 109, 1994, 321.
[4] Simon a. O. 1996, 16 Anm. 8.
[5] St. Geroulanos – R. Bridler, Trauma. Wund-Entstehung und Wund-Pflege im antiken Griechenland (Mainz 1994) 57 f.
[6] H. A. Johnson MD, The foot that stalled a thousand ships: a controversial case from the 13th century BC, J R Soc Med 96, 2003, 507 f.
[7] ders. a. O. 508.
[8] ders. ebenda.
[9] Geroulanos – Bridler a. O. 57 f.
[10] Müller a. O. 322 Anm. 4.
[11] Müller a. O. 340 Anm. 63 f.
[12]Simon a. O. 18, dazu auch brieflich am 20.03.2016.
[13]Soph. Phil. 735-816.
[14] LIMC VII (1994) 376-385 Nr. 12-74 Taf. 321-326 s. v. Philoktetes ( M. Pipili); Simon a. O. 1996, 15 Anm. 4. 5.
[15]Dazu W. Wamser-Krasznai, In Schönheit sterben, in; dies., Fließende Grenzen (Budapest 2015) 22-35.
Copyright Dr. Dr. Waltrud Wamser-Krasznai
-
Gemarterte Füße
Unter dem Diktat der Schuhmode im Altertum
Erinnern wir uns zunächst an die verschiedenen Fußtypen. Da gibt es den ägyptischen Fuß (Bild 1), bei dem die Zehen wie die Orgelpfeifen nebeneinander liegen.
Bild 1. Figürliches Gefäß (Kreta?) um 600 v. Chr.
Bonn, Akademisches Kunstmuseum. Photo: W. Wamser-Krasznai
Beim griechischen Fuß dagegen ist die zweite Zehe am längsten (Bild 2).
Bild 2. Fuß des Kaisers Constantin, Anf. 4. Jh. n. Chr.
Nachbildung Trier. Photo: W. Wamser-Krasznai
Sind alle Zehen nahezu gleich lang dargestellt, dann sprechen wir salopp von einem „Quadratfuß“ (Bild 3). In der Natur ist er nicht leicht zu aufzutreiben; doch bleiben wir hier bei der antiken Kunst.
Bild 3. Dame d’Auxerre, Paris, ca. 640/630 v. Chr.
Nach Martini 1990, 47 Abb. 13
Sie – die antike Kunst nämlich – ist überraschend reich an Darstellungen von Füßen, die wir heute als krankhaft verändert, als deformiert oder leicht beschönigend als „von der Norm abweichend“ bezeichnen würden. Jeder Orthopäde kennt das Bild der verdickten schmerzhaften Ferse, die nach einem schwedischen Kollegen Haglund-Ferse oder Haglund-Exostose heißt (Bild 4).
Bild 4. Haglundferse
Nach Rössler – Rüther 2007, 331 f. Abb. 16.74 a
Sie ist entweder die Folge einer Verknöcherungsstörung der Calcaneus-Apophyse im Wachstumsalter oder die einer überschießenden Verknöcherung am Ansatz der Achillessehne, die durch permanenten Druck der Fersenkappe bei einem Schuh von mangelhafter Passform entsteht. Da schon der bloße Anblick einer derartigen Ferse schmerzt, ist es verblüffend zu erfahren, dass ähnliche Höcker zu bestimmten Zeiten offenbar für besonders darstellenswert galten – etwa im Ägypten der Amarnazeit (Bild 5).
Bild 5. 14. Jh. v. Chr.Berlin, Neues Museum
Photo: W. Wamser-Krasznai
Auch im antiken Griechenland, das der Schönheit und dem Ebenmaß geradezu leidenschaftlich ergeben war, ist die Wiedergabe einer Exostose keine Seltenheit. So weihte man gegen 500 v. Chr. eine Kore, die Statue eines Mädchens, auf die Athener Akropolis, in der Absicht, der Göttin Athena, Schutzpatronin der Stadt, ein kostbares Geschenk zu machen. Die Vorwölbung oberhalb des Calcaneus, des Fersenbeins, ist nicht zu übersehen (Bild 6). Was kann den Bildhauer veranlasst haben, den hinteren Abschnitt eines Mädchenfußes mit einer derartigen Protuberanz auszustatten, um nicht zu sagen: zu verunstalten?
Bild 6. Spätarchaische Kore, Athen, Akropolis Nr. 682
Nach Richter 1968, 71 f. Abb. 364
Die Vorwölbung erscheint uns als pathologisch, mindestens aber als unschön. Ihre Wiedergabe ist keine Ausnahme und beschränkt sich weder auf das weibliche Geschlecht, noch auf die Zeit der Archaik oder Frühklassik (Bild 7).
Bild 7. Krieger vom Aphaia-Giebel West links, ca. 480/70 v. Chr.
Glyptothek München. Photo: W. Wamser-Krasznai
Sogar das Votiv-Bein auf einem Weihrelief an die Heilgötter Asklepios und Hygieia zeigt eine mäßige Verdickung am oberen Fersenrand (Bild 8).
Bild 8. Weihrelief aus Melos, römische Kaiserzeit
British Museum London. Photo: W. Wamser-Krasznai
Was steckt hinter derartigen Äußerungen künstlerischer Gestaltung? Vermutlich war der Skulpteur durch ein lebendes Vorbild angeregt. Er mag es interessant, vielleicht nicht gerade „schön“, auf jeden Fall aber darstellenswert gefunden haben.
Wodurch sind die Vorwölbungen verursacht? Nun – sie entstanden und entstehen auch heute noch durch den permanenten Druck eines Schuhwerks von mangelhafter Passform auf die empfindlichen Teile des Fußes. Damit ist nicht erklärt, weshalb der Höcker bei antiken Darstellungen zumeist etwas höher sitzt als die Fersenkappe eines heutigen Halbschuhs.
Wie sieht das antike Schuhwerk aus, das einen Fuß zu quälen und krankhafte Reaktionen hervorzurufen vermag? Die Joch- und Netzwerksandalen des 6. und 5. Jhs. v. Chr. (Bild 9) eignen sich offensichtlich wenig dazu, den nötigen Druck zu erzeugen.
Bild 9. Gefäß in Form eines Fußes mit Netzwerksandale
Um 525-500 v. Chr. London, British Museum.
Photo: W. Wamser-KrasznaiAuch geschlossene Schuhe müssen nicht fußfeindlich sein, vorausgesetzt, sie bestehen aus einem schmiegsamen Material. Zwar ist die Ferse selbst (Bild 10) nicht zu sehen, doch lässt sich aus der Form des vorderen Schuhabschnitts auf einen weichen Stoff schließen. Ein Zusammenhang zwischen zeittypischem Schuhwerk und der Angabe eines Fersenhöckers am nackten Fuß ist hier nicht zu erkennen.
Bild 10. Füße der Nikandre, Athen, ca. 660 v. Chr.
Nach Martini 1990, 92 Abb. 26
Wenden wir uns noch einmal dem Fuß unserer Kore, und zwar dem vorderen Abschnitt, zu (Bild 11).
Nach Karakasi 2001, 172 Taf. 252 c
Wir sehen, wie der Querriemen der zierlichen Sandale die kleine Zehe aus ihrer naturgewollten Stellung in die Adduktion drängt, d. h. an die vierte Zehe heranzieht. Das Martyrium hat begonnen. In allernächster Zeit wird ein schmerzhafter Kleinzehenballen entstehen, das Gegenstück zum Hallux valgus. Damit ist ein bedeutsames Stichwort gefallen.
Sextus Pompeius Festus (2. Jh. n. Chr.) stellt hallux und hallestai= ἃλλεσθαι (hinaufspringen) sprachlich nebeneinander und beschreibt sie im Lateinischen als „pollex (pedis) scandens super proximum, dictus a saliendo“ – als großen Zeh, der über den nächsten steigt, weil er gleichsam auf diesen hinaufgesprungen scheint[1] (Bild 12).
Bild 12. Hallux valgus
Nach Rössler – Rüther 2007, 331-333 Abb. 16.76 a
Dass die große Zehe im Gegensatz zu den anderen nur aus zwei Phalangen besteht, war schon Galen[2] bekannt und wurde von ihm als eine der tektonischen Voraussetzungen für die Stabilität des medialen Längstragbogens gesehen[3].
Die Entwicklung der geradeaus nach vorn gerichteten Großzehe zum Hallux valgus lässt sich an Bildwerken der Antike verfolgen. Beginnen wir mit den Jahren um 570 v. Chr., zunächst in Attika, in der Gegend von Athen. Trotz der hohen Sohle ist die Welt für den Fuß noch in Ordnung (Bild 13).
Bild 13. Detail der sog. Berliner Göttin, ca. 570 v. Chr.
Photo: W. Wamser-Krasznai
Wir bleiben ungefähr in dieser Zeit und bei demselben Sandalentypus, der von seiner Grundform her dem Fuß keine Gewalt antut, begeben uns aber nach Etrurien. Wie wir sehen, zieht der Sandalenriemen die große Zehe aus ihrer geraden Richtung nach außen gegen die 2. Zehe, nach lateral, wie wir sagen. Spreizfuß und Hallux valgus kündigen sich an (Bild 14). Bereits im Altertum müssen also negative Kräfte auf den Fuß eingewirkt haben, die stärker waren als dessen empfindlichste Teile.
Bild 14. Detail einer Frauenstatuette aus Vulci/Etrurien, Anf. 6. Jh. v. Chr.
Brit. Mus. London, nach Sprenger – Bartoloni 1977, 93 f. Abb. 46 b.
Wir brauchen nicht weit zu suchen, um die Ursachen zu finden. Auch in der Antike gab es Zeiten, in denen es schick war, extrem spitze Schuhe zu tragen (Bild 15).
Bild 15. Kore Akropolis 683, spätarchaische Zeit
Nach Richter 1968, 77 f. Abb. 384
Die junge Frau ist mit einem vollkommen „symmetrischen“ Halbschuh bekleidet. Bei diesen hochgradig fußfeindlichen Konturen hilft es nicht viel, wenn wir annehmen, dass es sich um einen „griechischen Fuß“ handelt, dessen längste Zehe, die zweite, sich bis in die Schuhspitze hinein ausstrecken kann. Der Hallux, die Zehe Nr. 1, wird ja trotzdem rigoros nach lateral, nach außen, gedrängt. Das ist aber nicht alles. Auch die kleinen Zehen, die vierte und fünfte, geraten unter Druck, und zwar nach medial, zur Mitte hin. Alles im Dienste der Schönheit! Vollends in der Spätantike scheint ein handfester Spreizfuß dem Schönheitsempfinden nicht widersprochen zu haben. Wie hätte sonst ein Elfenbeinschnitzer es wagen können, eine Göttin, noch dazu Hygieia, die Göttin der Gesundheit, mit einem so ausgeprägten Hallux valgus darzustellen (Bild 16)?
Bild 16. Hygieia mit Spreizfuß, Elfenbeindiptychon ca. 400 n. Chr.
Nach Simon 1990, 25 Abb. 22
Modische Narrheit war auch in der Antike nicht auf das weibliche Geschlecht beschränkt. Das Schuhwerk des karischen Satrapen Maussolos von Halikarnassos drängt die große Zehe ebenfalls in die Valgisierung, d. h. nach außen, den armen gequetschten kleinen Zehen entgegen (Bild 17).
Bild 17. rechter Fuß des Maussollos. Mitte 4. Jh. v. Chr.
London, Brit. Mus. Photo: W. Wamser-Krasznai
Was sagen die antiken Schriftsteller dazu? Von Plutarch ist die folgende Episode überliefert: Ein Römer, der von seinen Freunden getadelt wird, weil er seiner sittsamen, reichen und schönen Frau den Scheidebrief geschickt habe, streckt seinen Fuß vor und sagt: Auch dieser Schuh ist schön anzusehen und neu, aber niemand weiß, wo er mich drückt[4]. Pikanterweise sind es gerade die Füße des schönen Apollon vom Belvedere, die sich dazu eignen, einen solchen Text zu illustrieren (Bild 18). Die Art, wie der Sandalenrand die erste, zweite und fünfte Zehe beeinträchtigt und ihnen den notwendigen Spielraum nimmt, ist geradezu ein Musterbeispiel für das Martyrium des Fußes.
Bild 18. Linker Fuß des Apollon, 330/20 v. Chr.
Nach Dohan Morrow 1985, 106 Abb. 96
Aristophanes, der alte Spötter, legt einem Ehemann, der sich gern einmal ein Paar anständige Hörner aufsetzen lässt, die folgende Bitte in den Mund:
„O Schuhmacher, meiner Frau quetscht der Schuh das kleine Fußzehchen zusammen, es ist ja so zart. Komm du zur Mittagszeit und weite ihn, auf dass er größer sei…“ (Lysistrate).
Ein Exkurs ins Mittelalter zeigt, dass es dem vornehmen Ratsherren nicht genügte, Schuhe mit lang ausgezogenen Schnäbeln zu tragen, nein, er bindet sich noch ein Glöckchen an die Spitze, damit jedermann hören und sehen kann, wie er um der Mode willen einen Narren aus sich macht (Bild 19).
Bild 19: Gotisches Schuhwerk im Miniaturformat,
Meister Richard Fenchel, Butzbach. Photo: W. Wamser-Krasznai
Auch missgebildete Götterfüße lässt die antike Bilderwelt ausnahmsweise zu. Beim Klumpfuß handelt es sich bekanntlich um ein angeborenes Leiden. Hephaistos, der Gott der Schmiede, sagt von sich, dass er „als Krüppel zur Welt“ kam[5], was ihn aber nicht hindert, Karriere als Kunsthandwerker zu machen und mit seinen Erzeugnissen weithin berühmt zu werden. Auf Bitten der Göttin Thetis schmiedet er die Waffen für ihren Sohn Achilleus (Bild 20), allerdings ohne diesen damit vor dem tödlichen Pfeilschuss in die Ferse, seine einzige verwundbare Stelle, retten zu können.
Bild 20: Hephaistos / Sethlans zwischen Thetis und Achill
Etruskischer Karneolskarabäus, 530/520 v. Chr. nach LIMC IV, 1988
„Dem Musiker Dorion, der einen Klumpfuß hatte, kam“, wie Athenaios berichtet[6], „bei einem Symposion der Schuh des behinderten Fußes abhanden“ – man streifte ja bekanntlich die Schuhe ab, bevor man sich zu Tische legte – Dorion also sagte, „Ich will dem Dieb nichts Schlimmeres wünschen, als dass ihm der Schuh passt“.
Unsere Betrachtungen zur Diktatur der Schuhmode im Altertum blieben unvollständig ohne einen Blick auf ihre Auswüchse. Wer Schillers Balladen noch kennt, dem fallen zum hochsohligen Schuh des Schauspielers „Die Kraniche des Ibykus“ ein. Dort heißt es:
So schreiten keine ird’schen Weiber,
die zeugete kein sterblich Haus.
Es steigt das Riesenmaß der Leiber
Hoch über Menschliches hinaus.Bild 21: Römisches Mosaik, 3. Jh. n. Chr.
Altes Museum Berlin. Photo: W. Wamser-Krasznai
Häufig wird der Kothurn vorschnell mit dem stelzenartigen Schuh der römischen Kaiserzeit assoziiert. Doch seine Grundform war flach. Er hatte einen weichen, weiten Schaft und eine schnabelartige Spitze[7]. Ein solches Paar war symmetrisch geschnitten, sodass beide Schuhe jeweils an beide Füße passten[8]. Sie waren, um es mit Galen zu sagen, über einen Leisten geschlagen[9]. Die Erhöhung der Sohlen beginnt erst im Hellenismus und steigert sich weiter in der römischen Kaiserzeit (Bild 21).
Neben den hohen Kothurnen gab es die sog. Tyrrhenischen Sandalen[10]. Sie hatten vergoldete Riemen und Sohlen von extremer Höhe.
Mit der Aufforderung: Folge mir! versprechen die Abdrücke genagelter Schuhsohlen allerlei Liebesfreuden (Bild 22).
Bild 22: Akolouthi! Folge mir! 2./3. Jh. n. Chr.
Nach Lau 1967, 93 Abb. 19
„Die Frauen treiben es so weit, dass sie mittels der Schuhnägel ihre Schuhsohlen…mit Liebesgrüßen…dekorieren…und dem Boden…wie mit einem Siegelstempel ihre Courtisanengedanken aufprägen“, klagt Clemens von Alexandria[11] .
Wann und wo begegnen uns antike Fuß-Darstellungen, die dem natürlichen Ebenmaß Rechnung tragen und frei sind von Anzeichen des Martyriums?
Ein erfreuliches Beispiel geben manche Statuen von Kleinkindern (Bild 23).
Bild 23. Der kindliche Herakles als Schlangentöter
Rom, Kapitolinische Museen. Photo: W. Wamser-Krasznai
Beim Erwachsenen ist das ebenso selten wie in unserer heutigen, ach so zivilisierten Welt. Wir begeben uns auf die Insel Samos und gehen weit zurück, in die Mitte des 6. Jhs. v. Chr. (Bild 24). Da schuf der Künstler die Bronzestatuette eines zierlichen Mädchens und umkleidete den „ägyptischen Fuß“ mit einem geschlossenen Schuh. Dabei ließ er den Zehen ihre naturgegebene Freiheit, ohne sie gewaltsam in eine andere Form zu pressen.
Bild 24. Korenstatuette aus dem Heraion, um 550 v. Chr.
Bronze. Berlin, Altes Museum. Photo: W. Wamser-Krasznai
Nur – entspricht dies dem heutigen Schönheitsempfinden? Wohl kaum!
Eher könnten wir uns mit der Form des Sandalengefäßes (Bild 1) befreunden. Auch da liegen die Zehen, wir sagten es schon, bequem nebeneinander „wie die Orgelpfeifen“.
Es ist davon auszugehen, dass die antiken Künstler erstens ihre Anregungen aus dem Leben nahmen, und dass sie zweitens die kleineren und größeren Abweichungen von der physiologischen Norm in ihr und ihrer Zeitgenossen klassisch-hellenistisches Schönheitsideal aufnahmen. Weihgaben an die Gottheit oder gar Statuen von Göttern als unschön, hässlich, krankhaft darzustellen wäre verwerflich. Der Künstler hätte riskiert, nicht nur den Unmut der Gottheit hervorzurufen, sondern auch seine Auftraggeber zu verlieren. Die Wiedergabe verformter Füße wie im Fall von Hephaistos (Bild 20) stellt eine Ausnahme dar, die einen besonderen Gott auf besondere Art kennzeichnet[12]. So bleibt es nach allem, was wir gesehen haben, auch in der Antike bei der betrüblichen Tatsache: Wer schön sein will, muss leiden[13]. Um derart unangenehmen Wahrheiten zu entgehen, haben wir die Möglichkeit, das Symposion zu verlassen, nachdem wir uns die Schuhe haben bringen zu lassen[14], oder eleganter…
wir schnallen uns Flügel an die Füße und gehen in die Luft! (Bild 25)
Bild 25. Hermes mit geflügelten Schuhen, 500-490 v. Chr.
Nach Zanker 1965, 31 Taf. 5 a
Abgekürzt zitierte Literatur und Abbildungsnachweis:
Bieber 1941: M. Bieber, Ne supra crepidam sutor iudicaret, AJA 45, 1941, 62f.
Dohan Morrow 1985: K. Dohan Morrow, Greek Footwear and the Dating of Sculpture (Madison 1985)Bild 18
Karakasi 2001: K. Karakasi, Archaische Koren (München 2001) Bild 11
Lau 1967: O. Lau, Schuster und Schusterhandwerk in der griechisch-römischen Literatur und Kunst (Bonn 1967) Bild 22
LIMC IV 1988: LIMC IV (1988) 657 Nr. 18 a Taf. 405 s. v. Sethlans (I. Krauskopf) Bild 20
Martini 1990: W. Martini, Die archaische Plastik der Griechen (Darmstadt 1990) Bild 3. 10
Michler 1986: M. Michler, Zum Hallux valgus in der Antike, in: W. Blauth (Hrsg.), Hallux valgus (Berlin – Heidelberg 1986) 1-18
Richter 1968: G. M. A. Richter, Korai (London 1968) Bild 6. 15
Rössler – Rüther 2007: H. Rössler – W. Rüther, Orthopädie und Unfallchirurgie (München 2007) 331-333 Abb. 16.74 a und 16.76 a Bild 4. 12
Simon 1972: E. Simon, Das antike Theater (Heidelberg 1972)
Simon 1990: E. Simon, Die Götter der Römer (München 1990) Bild 16
Sprenger – Bartoloni 1977: M. Sprenger – G. Bartoloni, Die Etrusker. Kunst und Geschichte (München 1977) Bild 14
Wamser-Krasznai 2005: W. Wamser-Krasznai, Wer schön sein will, muss leiden…oder Glanz und Elend des menschlichen Fußes, Orthoprof. 4/2005, 5-9
Wamser-Krasznai 2013: W. Wamser-Krasznai, Hephaistos – ein hinkender Künstler und Gott, in: dies., Auf schmalem Pfad (Budapest 2013) 72-82.
Zanker 1965: P. Zanker, Wandel der Hermesgestalt in der attischen Vasenmalerei (Bonn 1965) Bild 25
[1] Michler 1986, 2.
[2] Griechischer Arzt, geb. ca. 130 n. Chr. in Pergamon, gest. nach 204 n. Chr. in Rom.
[3] Gal., De usu partium lib. III, c.8; Michler 1986, 3 Anm. 11.
[4] Plut. mor. conjung. praec. 141, 22.
[5] Homer, Od. 8, 310-311.
[6] Athen. Gelehrtenmahl 8, 338 a.
[7] Simon 1972, 23 f.
[8] Lau 1967, 128 f.
[9] Gal., De sanitate tuenda lib. V, 11.
[10] Dohan Morrow 1985, 183 mit Anm. 77. Eindrucksvolle Abbildung z. B. in: Pergamon. Panorama der antiken Metropole (Berlin 2011) 491 Nr. 4.3.
[11] Paedagogus XI, 11.
[12]Dazu: Wamser-Krasznai 2013, 72-82.
[13]Wamser-Krasznai 2005.
[14] Vorführungen durch Behinderte wurden von gewissen Zuschauern abgelehnt. Sie ließen sich „die Schuhe bringen“, um das Symposion zu verlassen, Pliniusbrief 9, 17.
-
Nicht nur zum Waschen….
Vom Wasser in der Antike
Bild 1: Salvom lavisse, bene lava – „Angenehmes Baden!“
Mosaiken in Sabratha/Libyen. Photo der Verfasserin, 2009In den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts kam ein Liedchen auf, dessen Refrain „Wasser ist zum Waschen da, falleri und fallera…..“ im Handumdrehen Karriere als Ohrwurm machte. Der ausführliche Text geht populär persiflierend auf einige der wichtigsten Aspekte des Wassers ein.
Sehen wir uns daraufhin bei den antiken literarischen Quellen um, so lesen wir bei Platon von der Einteilung der Erdbewohner in solche, die innerhalb und andere, die außerhalb der Säulen des Herakles[1] leben (Plat. Kritias 108 e), nämlich die Einwohner von Attika und Atlantis. Dem ersteren, griechischen, Lande gab Zeus Jahr für Jahr reichlich Wasser, das aber nicht wie heute von der nackten Erde ins Meer abfloss, sondern vom Erdreich aufgenommen wurde und sich zusätzlich in Hohlräumen sammelte. Überall gab es „Ströme von Quellwassern und Flüssen. An ihren ehemaligen Quellen auch jetzt noch erhaltene Heiligtümer…“ (Plat. Kritias 111 d). Er geht dann zu den Verhältnissen in Atlantis über, einer Insel, die im Losverfahren dem Bruder des Zeus, Poseidon, zugefallen war. Auch dort quoll kaltes und warmes Wasser aus dem Boden, „wobei jedes von beiden nach Wohlgeschmack und Güte … für den Gebrauch wunderbar geeignet war … und sie schufen ringsum Wasserbassins, die teils unter freiem Himmel lagen, teils überdachte Winterbassins für die warmen Bäder, und zwar getrennt für die Könige und die Privatleute, ferner für die Frauen (sic!), weitere für Pferde und die übrigen Zugtiere…“ (Plat. Kritias 117 a. b).
Wir hören vom Geschmack des Trinkwassers, von üppiger Vegetation und blühender Viehzucht in ihrer Abhängigkeit vom Wasser, aber auch von Badebecken mit kaltem und warmem Wasser, das nicht nur den Einwohnern, getrennt nach Geschlechtern und sozialem Stand, sondern auch den größeren Nutztieren zur Verfügung stand (Plat. Kritias 111 b. c). Zudem erfahren wir von den Kultorten in der Nähe der Quellen, wo man die Gottheiten, die das Leben spendende Wasser schenken[2], verehrt.
Trinkwasser
Qualvoll ist es, nicht trinken zu können, wenn man Durst hat. So übel ergeht es dem Frevler Tantalus, der zur Strafe im Tartaros unablässig am Trinken gehindert wird:
„Dürstend stand er und konnte es doch nicht erreichen.
Denn sooft er sich bückte, der Greis, im Wunsche zu trinken,
zog sich das Wasser zurück und verschwand, und unter den Füßen zeigte sich schwarze Erde. Ein Dämon machte sie trocken.“ (Hom. Od. 583-586)Zu den frühen Schriften, die im Umkreis des Hippokrates entstanden, zählt die Abhandlung „Über Luft, Wasser und Orte“, auch „Über die Umwelt“ genannt. Darin wird dem in einer fremden Stadt Ankommenden empfohlen, genau zu „überlegen, …wie es mit den Gewässern steht, ob die Menschen sumpfiges oder weiches Wasser trinken oder hartes, das von felsigen Höhen fließt, oder salziges und schwerverdauliches…“[3].
Keine Wasserart war in der Antike so hoch geschätzt wie das Quellwasser. Die Entnahmestelle, Krene, wurde durch eine Einfassung geschützt. Schöpf- und Laufbrunnen[4] entstanden. Man legte überdachte Reservoirs, Gefälleleitungen, steinerne Kanäle und Rohrleitungen an. Letztere bestanden überwiegend aus Ton oder Blei[5]. Trinkwasser für Rom und Italien war vor allem zur Zeit des Trajan (109-117 n. Chr.) ein kaiserliches Anliegen. Zum Teil musste das kostbare Nass mittels Aquaedukten über weite Strecken herangeführt werden. Es gab einen Wasserdirektor, den curator aquarum, und man feierte die Fontinalia zu Ehren des Quellgottes Fons, der in Rom Staatskult genoss[6].
Bild 2: Aquaedukt von Olbia Diokaisarea, Kilikien, 2. Jh. n. Chr.
Aufnahme der Verfasserin, 2013Reinigendes Wasser
Über die Wohltat des Bades ergeht sich Homer in ausführlichen Schilderungen. Dem staubigen, verschwitzten Gast bietet der Gastgeber neben Speise und Trank auch warme Bäder und frische Kleider.
Und so
„Stiegen sie ein zum Bad in die wohlgeglätteten Wannen.“ (Hom. Od. 4, 48)
„Und eine Dienerin brachte in schöner goldener Kanne Handwaschwasser und netzte damit über silbernem Becken Ihnen die Hände….“ (Hom. Od. 4, 52 f.)Letzteres entsprach wohl eher einem Ritual als übertriebenem Reinlichkeitsbedürfnis. Auch die Fußwaschung, die das Behagen des Gastes erhöht, ist Teil des Begrüßungszeremoniells:
„…Und die Alte ergriff die blinkende Wanne,
Die zum Waschen der Füße diente, und füllte viel
Kaltes Wasser hinein und schöpfte dann warmes dazu…“(Hom. Od. 19, 386-88)
Bild 3: Eurykleia bei der Fußwaschung des Odysseus
Nach Furtwängler-Reichhold 1904, Taf. 142[7]Draußen erfreuen sich Nausikaa und ihre Freundinnen am fließenden Wasser:
Und sie badeten sich und salbten sich mit dem Salböl
…..bis die Gewänder vom Strahle der Sonne getrocknet (Hom. Od. 6, 96).
Zuweilen entwickelt das Reinigungsbad geradezu therapeutische Eigenschaften:
„Als das Wasser dann heiß im blanken erzenen Kessel,
Setzte sie (Kirke) mich ins Bad und goss es aus mächtigem Dreifuß
Mir mit duftenden Kräutern vermischt übers Haupt und die Schultern,Bis sie mir die verzehrende Mattheit nahm von den Gliedern.“(Hom. Od. 10, 360-365)
Bild 4: aus Amathous/Zypern, 7./6. Jh. v. Chr.
nach Karageorghis 1995, 140-142 Taf. 81, 1Noch deutlicher wird das in der Ilias:
Nestor lässt ein Bad für Machaon richten:„Bis dass ein warmes Bad Hekamede mit kräftigen Flechten
Für dich wärmt und abwäscht den blutigen Schorf von der Wunde.“(Hom. Il. 14, 6)[8].
Achill lehnt zum Zeichen der Trauer die Wohltat des Bades ab,
„Ehe Patroklos nicht ist verbrannt und das Mal ihm geschüttet“
(Hom. Il. 23, 39-45)
Erst danach erlauben die Gebräuche,
„Einen Dreifuß ans Feuer zu stellen, um zu versuchen,
Den Peliden rein zu waschen vom blutigen Schorfe.“Wasser in Mythos und Kult
Berühmte Orakel gehen direkt von einer Quelle aus. Es… „befindet sich in den Trümmern von Hysiai (im Gebiet von Platiai / Böotien)…ein heiliger Brunnen; einst holte man sich …aus dem Brunnen durch Trinken Orakel“ (Paus. IX 2, 1). Auch an anderen Orten wird die Kraft der Weissagung durch einen Trunk aus einem Brunnen oder einer Quelle verliehen[9]. Hellseherische Begeisterung ist eine Gabe der Nymphen[10]. Die überwältigende Erfahrung der Ergriffenheit durch die Nymphen, der Nympholepsie, vermag die Menschen mitzureißen und in Verzückung zu versetzen. Als Folgen einer Erweiterung des Bewusstseins und geschärfter Wahrnehmung können sich besondere rhetorische Fähigkeiten[11] und gesteigerte Ausdruckskraft einstellen[12]. Der schöne Jüngling Hylas freilich wird von den Nymphen in Persona ergriffen und in die Tiefe gezogen[13].
Aus der engen Beziehung des göttlichen Geschwisterpaars Artemis und Apollon zur Reinheit ergibt sich deren Affinität zu allen strömenden Gewässern. Das begann bereits vor der Geburt der Zwillinge, da Leto, die von der eifersüchtigen Hera verfolgte werdende Mutter, die thessalischen Nymphen um Fürsprache beim Flussgott Peneios bat, damit dieser seine Fluten anhielt und ihr so die ruhige Geburt im Flussbett ermögliche (Kall. h. in del. 109). Später gehörten zahlreiche Nymphen zu den dienenden Begleiterinnen der Artemis[14]. Wasser ist heilig, da es jede Art von Befleckung wegzunehmen vermag[15]. Auch zu den Asklepieia[16] gehört die Nähe von Quellhäusern und Brunnenanlagen, denn: „Rein muss sein, wer in den duftenden Tempel tritt, rein sein ist aber, heilige Gedanken zu haben“[17]. Plutos (= der reiche Mann) begibt sich, nachdem er sich durch Baden im Meer gereinigt hat, mit seinen Begleitern in den heiligen Bezirk des Asklepios, wo die Opfer, Honigkuchen und anderes Backwerk, auf dem Heiligen Tisch deponiert werden (Aristoph. Plut. 660-663).
Ein Trunk aus den Wassern der Lethe endlich lässt die Verstorbenen ihre Erdenschicksale vergessen, auf dass ihnen die Ruhe des Hades zuteilwerde[18].
Wasser und Heilwässer zu therapeutischen Zwecken
Frühe Spuren des Gebrauchs von Heilwässern finden sich in Griechenland und seinen westlichen Kolonien in den Gegenden, die über zahlreiche „gesunde Flüsse“ und natürliche, durch Calor, Odor und Color[19] auffällige Quellen verfügen[20]. „Am blauesten ist das Wasser, das ich an den Thermopylen sah, aber nicht alles, sondern nur das, das in das Schwimmbecken fließt, das die Einheimischen ‚Frauenwannen‘ nennen“ (Paus. IV, 35, 9).
Auch Herodot wusste davon:
„Im Westen der Thermopylen…gibt es warme Quellen, die die Einheimischen ‚Kochtöpfe‘ nennen“ (Hdt. VII, 176, 3)[21].
In der Argolis steigt Süßwasser aus dem Meer auf (Paus. VIII, 7, 2), aber vor Dikaiarcheia (Puteoli=Pozzuoli) im Etruskerland“ gebe „es kochendes Wasser im Meer und eine künstliche Insel dafür, damit auch dieses Wasser nicht ungenutzt bleibe, sondern ihnen zu warmen Bädern diene“ (Paus. VIII, 7, 3).
Doch Hippokrates warnt: „Wo warme Gewässer aus dem Boden kommen oder Eisen, Kupfer, Silber, Gold, Schwefel, Vitriol, Erdpech oder Natron vorhanden sind – solches Wasser halte ich zu jeder Verwendung für schlecht.“ (Hippokr. Schriften „Über Luft, Wasser und Ortslagen“)[22]. Bittere Erfahrung machte ein Athener, der an Pachydermie und Juckreiz litt: …„dabei war die Haut dick über den ganzen Körper und sah wie die Schuppenflechte (lepra) aus; an keinem Körperteil konnte man die Haut abheben wegen ihrer Dicke…“. Er „reiste nach Melos, wo die warmen Bäder sind; hier genas er vom Juckreiz und von der Dickhäutigkeit (pachydermia), starb aber an der Wassersucht“. (Hippokr. Schriften „Über die epidemischen Krankheiten“) [23]. Das ist nicht gerade ermutigend. Mehr Hoffnung macht 500 Jahre später Pausanias:
„In Samikon[24] ist eine Höhle nicht weit vom Fluss, die Höhle der anigridischen Nymphen genannt. Und wer mit der Weißfleckenkrankheit hineingeht, muss zuerst zu den Nymphen beten und ihnen ein Opfer geloben, und dann lösen sich die kranken Stellen des Körpers ab. Wenn er den Fluss durchschwimmt, lässt er jenen Schaden in seinem Wasser zurück und steigt gesund und mit gleichmäßiger Hautfarbe heraus“ (Paus. V, 5, 11).
Die elischen Nymphen werden gleich göttlichen Ärztinnen verehrt:
„Gegen 50 Stadien von Olympia entfernt liegt das elische Dorf Herakleia und dabei der Fluss Kytheros; eine Quelle ist da, die in den Fluss mündet, und ein Nymphenheiligtum an der Quelle. Jede der Nymphen hat ihren besonderen Namen“ (Paus. VI, 22, 7). Eine von ihnen trägt den sprechenden Namen Iasis, die Heilende. „Wenn man in der Quelle badet, erlangt man Heilung von Erschöpfung und verschiedenen Schmerzen…“
Neben den zahlreichen Heilnymphen war es besonders Herakles, der Heros der Arbeit, den man als Schirmherrn der Heilquellen verehrte. Unter seinem Schutz (oder dem des Asklepios?)[25] steht wohl auch die Magnesium-Sulfat-Therme von Himera auf Sizilien. Noch heute sei das 42o C warme Wasser in Gebrauch[26]. Eine um 420 v. Chr. geprägte Münze zeigt die Ortsnymphe bei der Libation vor einem Altar[27] sowie einen Satyr, der seine linke Schulter dem scharfen Strahl aus dem Löwenkopf-Wasserspeier aussetzt. Wir wollen für den kleinen Trabanten des Dionysos hoffen, dass er nicht an einer akuten Gelenkentzündung litt – dann könnte nämlich der Nutzen des „Blitzgusses“[28] leicht auf Seiten des behandelnden Arztes sein statt auf der des Patienten!
Bild 5: Silbernes Tetradrachmon, 430/420 v. Chr.
nach Franke 1964, 44 f. Taf. 22 aErgötzliches Wasser. Baden als Lustgewinn
In Rom wurde das Badewesen, das in republikanischer Zeit als moralisch nicht akzeptabel galt[29], zunächst mit Vorbehalt aufgenommen. Zwar hatte Scipio Africanus, der Sieger über Hannibal, in seiner Villa im kampanischen Liternum, in die er sich Anfang des 2. Jhs. v. Chr. zurückzog, ein kleines privates Bad, doch stand dieses in krassem Gegensatz zu dem Badeluxus, den man 250 Jahre später für selbstverständlich hielt[30]. 33 n. Chr. gab es in Rom bereits 170 öffentliche Bäder.
Bild 6: Hypokausten in der Hafentherme in Leptis Magna/Libyen
Aufnahme der Verfasserin, 2009Zu Zeit des Scipio erfreuten sich die Griechen bereits einer entwickelten Badekultur. Es gab Gemeinschaftsbäder mit Sitzwannen und Schwitzbad, Duschen und Becken, und auch ihre Sport- und Bildungsstätten, die Gymnasien, waren mit Badeanlagen ausgestattet. Durch Perfektionierung und Standardisierung der im griechisch-hellenistischen Kulturraum entwickelten Bodenheizungen und Badeanlagen[31] entstand ein Ambiente, das man sich ohne kostbare Marmorintarsien, Glasmosaiken und Nachbildungen berühmter griechischer Skulpturen nicht vorstellen konnte: die römische Therme.
Überkam den Badegast ein menschliches Rühren, so brauchte er einen angefangenen Dialog deshalb nicht zu unterbrechen. Latrinen waren Gemeinschaftsräume, Stätten der Kommunikation. Man konnte das WC, das von ständig fließendem Wasser durchspült wurde, in Gesellschaft betreten und, immerfort diskutierend, alle notwendigen Geschäfte dabei erledigen.
Bild 7: Latrine in der Hafentherme von Leptis Magna/Libyen
Photo der Verfasserin, 2009Für die Ableitung des Brauchwassers hatte man in Rom schon frühzeitig gesorgt, und zwar wie es die Überlieferung will durch die Ingenieure des etruskischen Königs Tarquinius Priscus, der die Cloaca maxima erbauen ließ. Aus dem unterirdischen Kanal wurde der flüssige Dreck – wohin wohl – natürlich direkt in den Tiber entsorgt. Das wird uns doch nicht überraschen? Betrachten wir nur einmal die Wasser der heutigen „schönen blauen Donau“ oder die des ebenso schönen Rheines!
Bild 8: Rom, Mündung der Cloaca maxima in den Tiber
Zustand 1958, Photo der VerfasserinÜbrigens handelt es sich bei der berühmten Bocca della verità in der römischen Kirche Santa Maria in Cosmedin möglicherweise um einen Kanaldeckel dieser Kloake[32].
Bereits in der frühen Römischen Kaiserzeit wuchs die Neigung zu Luxuria atque avaritia, Luxus und Habgier. Ausgehend von der Hauptstadt verbreitete sie sich über die Villenvororte vor allem in der kampanischen Küstenregion, den „goldenen Strand der Venus“ (Mart. Epigrammata XI, 80)[33]. Dort entwickelte sich Baiae zu einem ebenso beliebten und „schicken“ Modebad wie sehr viel später Bad Ischl zur Zeit der Donaumonarchie. In mancher Hinsicht freilich dürfte das kampanische Seebad das k. und k. Landstädtchen im Salzkammergut übertroffen haben. Wenn wir Martial und seinen dichtenden und schriftstellernden Zeitgenossen glauben wollen, so geriet Baiae nicht nur zu einem Zentrum der Üppigkeit und Schwelgerei, sondern auch zu einem wahren „Sündenbabel“. Wohlanständige Ehefrauen, die als keusche Penelope gekommen waren, verließen den Ort der Freuden nicht selten als kapriziöse Helena mit einem Paris im Gefolge (Mart. 1, 63) [34].
„Ihr trinkt sogar verschiedenes Wasser!“ (Juv. V 52) geißelt Juvenal „die neumodische Verbindung von übertriebenem Luxus mit schmutzigem Geiz“. Es war nämlich durchaus üblich, die Teilnehmer am Gastmahl ihren sozialen Stellungen entsprechend zu bewirten. Sich selbst und erlesenen Freunden ließ der Gastgeber Delikatessen auftragen. Für geringere Freunde war eine einfachere Bewirtungsklasse vorgesehen und eine dritte noch schlichtere für die Freigelassenen (Plin. Epist. II 6, 2 und 6)[35]. Doch vor erfahrenen ‚Symposiums-Haien‘ und dickfelligen Schnorrern vermochte das System den vermögenden Gastgeber nicht zu schützen.
Moderne Spa-Abteilungen und Wellness-Oasen in ehrgeizigen zeitgenössischen Hotels versuchen, sich dem Fluidum und den Attraktionen des „goldenen Strandes“ der römischen Kaiserzeit anzunähern, ganz im Gegensatz zu den heutigen Rehabilitations-Einrichtungen mit ihrer Atmosphäre von Ehrgeiz und Leistung. Übrigens bedeutet das Wort Spa weder eine Verstümmelung von Spa-ß-bad, noch handelt es sich um historisierende Abkürzungen wie „Sanus per Aquam, Salus per Aquam oder Sanitas per Aquam (Gesundheit durch Wasser). Das wäre zwar durchaus passend, aber nein, Spa hat seine Bezeichnung vom gleichnamigen belgischen Badeort, von dem ausgehend das Wort Spa seit dem 17. Jh. in Britannien für Mineralquellen und dann ganz allgemein als englisches Synonym für unser deutsches „Bad“ gebraucht wurde. Also nachgestellt, Bath Spa entsprechend Bad Nauheim?
Antike Bade- und Tafelfreuden gingen Hand in Hand. Man ließ seinen Rausch im Schwitzbad verfliegen, holte sich dort neuen Durst oder verlegte das weitere Zechen gleich ganz in die Therme[36]. Kein Wunder, dass es das folgende Distichon[37] zur Grabinschrift brachte:
Balnea, vina, venus corrumpunt corpora nostra,
sed vitam faciunt balnea vina venus.„Die Bäder, die Weine, die Liebe: sie richten den Körper zugrunde.
Doch sie sind auch das Leben: Die Bäder, die Liebe, der Wein“[38].Abgekürzt zitierte Literatur:
Benedum 1985: J. Benedum, Physikalische Medizin und Balneologie im Spiegel der Medizingeschichte, Zeitschrift für Physikalische Medizin, Balneologie und Medizinische Klimatologie 14, 1985, 141-159, hier 144
Benedum 1994: J. Benedum, Die Therapie rheumatischer Erkrankungen im
Wandel der Zeit (Stuttgart 1994)
Brödner 1983: E. Brödner, Die römischen Thermen und das antike Badewesen (Darmstadt 1983)
De Haan 2007: N. de Haan, Luxus Wasser. Privatbäder in der Vesuvregion, in: R. Aßkamp – M. Brouwer – J. Christiansen – H. Kenzler – L. Wamser (Hrsg.), Luxus und Dekadenz. Römisches Leben am Golf von Neapel (Mainz 2007), 122-137
Dierichs 2007: A. Dierichs, Am goldenen Strand der Venus, in: R. Aßkamp – M. Brouwer – J. Christiansen – H. Kenzler – L. Wamser (Hrsg.), Luxus und Dekadenz. Römisches Leben am Golf von Neapel (Mainz 2007), 31-41
E. Diez, Quellnymphen, in: Festschrift Bernhard Neutsch (Innsbruck 1980) 103-108
Franke 1964: P. R. Franke – M. Hirmer, Die griechische Münze (München 1964)
Hähner-Rombach (Hrsg.), „Ohne Wasser ist kein Heil“. Medizinische und kulturelle Aspekte der Nutzung von Wasser (Stuttgart 2005)
Heinz 1983: W. Heinz, Römische Thermen. Badewesen und Badeluxus (München 1983)
Kapferer-Sticker 1934-39: R. Kapferer – G. Sticker (Hrsg.), Die Werke des Hippokrates. Die hippokratische Schriftensammlung in neuer deutscher Übersetzung (Stuttgart 1934-39)
Karageorghis 1995: V. Karageorghis, The Coroplastic Art of Ancient Cyprus IV. The Cypro-Archaic Period. Small Male Figurines (Nicosia 1995)
Klöckner 2001: A. Klöckner, Menschlicher Gott und göttlicher Mensch? Zu einigen Weihreliefs für Asklepios und die Nymphen, in: R. von den Hoff – St. Schmidt (Hrsg.), Konstruktionen von Wirklichkeit. Bilder im Griechenland des 5. Und 4. Jahrhunderts v. Chr. (Stuttgart 2001)121-136
Krug 1985: A. Krug, Heilkunst und Heilkult (München 1985)
Laser 1983: S. Laser, Medizin und Körperpflege, ArchHom S, 1983
Ninck 1960: M. Ninck, Die Bedeutung des Wassers im Kult und Leben der Alten (Darmstadt 1960)
Pfisterer-Haas 2009: S. Pfisterer-Haas, Ammen und Pädagogen, in: Alter in der Antike, Bonn 25.2.2009-7.6.2009, 69-80
Rook 1992: T. Rook, Roman Baths in Britain (Buckinghamshire 1992)
Simon 31985: E. Simon, Die Götter der Griechen (München 31985)
Simon 2000: E. Simon, Römische Wassergottheiten, AW 3, 2000, 247-260
Steger 2005: F. Steger, Wasser in Kult und Medizin des Asklepios, in: S. Hähner-Rombach (Hrsg.), „Ohne Wasser ist kein Heil“ (Stuttgart 2005) 36-43
Tölle-Kastenbein 1990: R. Tölle-Kastenbein, Antike Wasserkultur (München 1990)
Steudel 1960: J. Steudel, Heilbäder und Heiltempel der Antike, Münchener Medizinische Wochenschrift 102/11, 1960, 513-519
Wamser-Krasznai 2006: W. Wamser-Krasznai, Frau „Kur“ und ihr Schatten, oder: Badelust von der Antike bis heute, Orthoprof 02/2006, 38-40
Wamser-Krasznai 2012: W. Wamser-Krasznai, Wie man sich bettet…Lager und Lagern in antiken Heil-Heiligtümern, Les Études classiques 80, 2012, 55-72
Wamser-Krasznai 2012/2013: W. Wamser-Krasznai, Wie man sich bettet…Lager und Lagern in antiken Heil-Heiligtümern, in: dies., Auf schmalem Pfad (Budapest 2012/2013) 55-71
Wamser-Krasznai 2015: W. Wamser-Krasznai, Vom Alter im Altertum, in: dies., Fließende Grenzen (Budapest 2015), 58-69
Weeber, Baden 2007: K.-W. Weeber, Baden, spielen, lachen. Wie die Römer ihre Freizeit verbrachten (Darmstadt 2007)
Weeber 2007: K.-W. Weeber, Luxuria, das „süße Gift“, in: R. Aßkamp – M. Brouwer – J. Christiansen – H. Kenzler – L. Wamser (Hrsg.), Luxus und Dekadenz. Römisches Leben am Golf von Neapel (Mainz 2007), 2-15
[1] Der Felsen von Gibraltar und der Berg Dschebel Musa auf der gegenüber liegenden Seite in Marokko.
[2] Diez 1980, 107.
[3] Krug 1985, 46 Anm. 7.
[4] Tölle-Kastenbein 1990, 21-37.
[5] Dies. a. O. 84-92; anscheinend sind bereits Vitruv mögliche Gesundheitsschäden durch die Verwendung von Bleirohren aufgefallen, ders., de architectura VIII (de aquis) 6, 10 f.
[6] Simon 2000, 255.
[7] Pfisterer-Haas 2009, Abb. 25; Wamser-Krasznai 2015, 63 Bild 6.
[8] Laser 1983, 138-143.
[9] = Hydromantik, Tölle-Kastenbein 1990, 12 f.
[10] Ninck 1960, 48.
[11] Man denke an die Redegabe der Echo, Ov, met. 3, 356-369.
[12] Klöckner 2001, 128; vgl. Plat. Phaidros 238 c. d.
[13] Simon 2000, 255 Abb. 13, unter Hinweis auf Goethes Gedicht “Der Fischer”, dessen Schlusszeilen zum geflügelten Wort gerieten: “halb zog sie ihn, halb sank er hin und ward nicht mehr gesehn“.
[14] Krause 1871, 143 f.
[15] Simon 31985, 158 f.
[16] Den Heiligtümern des Gottes Asklepios.
[17] Porphyrius (De abstinentia 2, 19), für Epidauros überlieferte Inschrift, Krug 1985, 130; Wamser-Krasznai 2012, 66; dies. 2012/2013, 66; anders Steger 2005, 37: für Kos überliefert (?)
[18] Ninck 1960, 104.
[19] Wärme, Geruch, Farbe.
[20] Benedum 1994, 125.
[21] Benedum 1985, 147.
[22] Kapferer-Sticker 1934-1939, Steudel 1960, 514; Benedum 1985, 144.
[23] Kapferer-Sticker ebenda; Steudel ebenda;; Benedum 1985, 148.
[24] In der Landschaft Elis, im Nord-Westen der Peloponnes.
[25] Franke 1964, 44 f. Taf. 22 a.
[26] Benedum 1985, 144.
[27] Trankopfer.
[28] Die mechanische und thermische Wirkung gezielter Wassergüsse wurde anscheinend seit 100 n. Chr. durch den Arzt Archigenes in größerem Umfang eingesetzt, Benedum 1985, 144. Diese Therapie hat, richtig angewendet, zwar noch heute ihren Stellenwert in der physikalischen Medizin, gehört aber längst nicht mehr zu den Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen!
[29] Rook 1992, 18.
[30] Seneca, Epistulae morales ad Lucilium 86; De Haan 2007, 123-137.
[31] Griechisches Hypokaustenbad 180-80 v. Chr., z. B. Brödner 1983, 8.
[32] Tölle-Kastenbein 1990, 168 f. Abb. 107.
[33] Dierichs 2007, 31.
[34] Steudel 1960, 517.
[35] Weeber, Baden 2007, 71-73.
[36] Petr. 73, 3 ff.; Quint. inst. or. I 6, 44; Weeber, Baden 2007, 14 f.
[37] Zweizeiler, aus einem Hexameter und einem Pentameter, die sich aus sechs bzw. fünf Hebungen zusammensetzen.
[38] Nach CIL VI 15258 (Corpus lateinischer Inschriften).
-
Vom Alter im Altertum.
Mit Texten und Bildern auf den Spuren einer „unheilbaren Krankheit“Zur Einstimmung seien ein paar Zeilen aus Elisabeth Herrmann-Otto, Die Ambivalenz des Alters[1], referiert:
Während in Sparta, einem oligarchischen Staatswesen, den mächtigen Alten uneingeschränkte Anerkennung zuteil wurde, hing in Rom, sowohl unter republikanischer als auch monarchischer Führung, alles von der sozialen Schicht ab. Für den geistig gesunden Angehörigen der Oberschicht gab es gleitenden Ruhestand, private Altersversorgung und hohe Wertschätzung. Die Mitglieder der Unterschicht dagegen hatten weder Ruhestand noch Altersversorgung zu erwarten. Ihnen drohten Armut und Verachtung.
Im demokratischen Athen dominiert der Kult der Jugend und der Männlichkeit, der die politische, soziale und ökonomische Marginalisierung der Alten, insbesondere der alten Frauen, zur Folge hat. Die unnützen Alten werden mit unzureichender Versorgung schutz- und fast rechtlos auf ihr nahendes Ende verwiesen. Zitat Ende.
Es ist Seneca, der feststellt: Senectus enim insanabilis morbus est, das Alter nämlich ist eine unheilbare Krankheit[2]. Aristoteles sieht darin eine natürliche Krankheit – νόσος φυσική[3], eine Art Austrocknungsprozess, ähnlich dem Verwelken der Pflanzen.
„Mir furchte bereits hier, da und dort
tief meine Haut das Alter
… weiß wurde das Haar,…
…nicht tragen mich mehr die Knie
…und tanzen so leicht wie Rehe.“klagt Sappho[4], die doch der Schönheit so leidenschaftlich zugetan ist, denn
„…euch, ihr Schönen, wird sich mein Sinn und Fühlen niemals entfremden.“Bild 1. Die Baseler Greisin
Antikenmuseum und Sammlung Ludwig (Photo Verf.[5])Auch der Spartaner Tyrtaios ruft aus: die Älteren, die schon keine flinken Knie mehr haben, lasst sie nicht im Stich….[6]
Und noch einmal die Knie, die nicht nur den beiden lyrischen Poeten, sondern auch dem Epiker Homer als Sitz und Sinnbild der jugendlich-raschen Fortbewegung gelten; Agamemnon spricht zum greisen Nestor die geflügelten Worte:
„Alter, würden doch so, wie dir der Mut in der Brust ist,
Deine Knie auch folgen, und wäre die Kraft dir beständig!“[7]Wir bleiben bei der Ilias und hören die Klage des Priamos:
„Dem Jüngling gereicht noch alles zur Zierde,…
jedoch das graue Haupt und das Kinn das ergraute,
… das ist wohl das kläglichste Bild für die elenden Menschen.“[8]
Nicht alle antiken Autoren äußern sich so negativ über das Alter. Für Salomo sind „Graue Haare … eine Krone der Ehre; auf dem Weg der Gerechtigkeit wird sie gefunden“[9]. Ebenfalls ermutigend klingt es bei Solon: „Wird auch silbern mein Haar, lern‘ ich doch immer noch vieles“[10].
Sehen wir einmal, wem graue Haare zur Ehre gereichen. Da ist Nestor mit seinem vielfältig klugen Rat, der die Achäer, die im Zorn auf einander entbrennen, mit honigsüßer[11] Rede besänftigt.
„Doch nicht alles zugleich gewähren die Götter den Menschen.
War ich ein Jüngling vordem, so drückt mich heute das Alter.
Aber auch so begleit‘ ich die Kämpfenden noch und ermahne
Sie mit Worten und Rat, denn das ist das Vorrecht des Alters.“[12]
Bild 2. Die Greise Nestor und Phoinix finden den toten Aias
(nach Simon[13]1981, 51 f. Abb. 28)
Auch der Gegner im troianischen Krieg, König Priamos, wird als würdiger Greis dargestellt. Gebeugt stützt er sich auf seinen Stab; das schüttere Haar ist grau.
Bild 3. Kriegers Abschied (nach Simon 1981, 101 Abb. 112)
Seine Gemahlin Hekabe, die ihm gegenüber steht, prangt in jugendlicher Schönheit. Sie ist es auch, die ihrem Abschied nehmenden Sohn Hektor die Waffen reicht.
Bekanntlich unterliegt Hektor im Zweikampf dem Griechen Achilleus.
Zuvor jedoch war Patroklos im Kampf gegen Hektor gefallen. Maßlos in seiner Trauer um den geliebten Freund lässt Achill sich nicht damit genügen, den Feind getötet zu haben.
Er „… ersann dem göttlichen Hektor schmähliche Dinge.
Denn er durchbohrte ihm hinten an beiden Füßen die Sehnen
Zwischen Knöchel und Ferse …
Band am Wagen sie fest und ließ den Kopf dabei schleifen.…“[14]
Zum unaussprechlichen Schmerz des Elternpaares Priamos und Hekabe, die von den Zinnen Trojas auf die unwürdige Szene blicken, schleift der Sieger den Toten von der Stadt bis zu den Zelten der Griechen. Dann liegt der Leichnam unter der Kline des zechenden und schmausenden Achilleus. Um den Sohn würdig bestatten zu können, erniedrigt sich der greise Priamos so weit, daß er sich, vom Götterboten Hermes geleitet, mit Wagenladungen voll Lösegeld dem Feind demütig bittend naht. Wen wundert es, daß Christa Wolf ihre Kassandra stereotyp wiederholen lässt: „Achill das Vieh“[15]…
Bild 4. Priamos vor Achill (nach Simon 1981, 112 f. 146)
Doch endlich „sich des grauen Hauptes erbarmend und Kinnes, des grauen,“[16]
gibt Achilleus den Leichnam frei, sodaß ihn der Vater bestatten kann.
Ein Beispiel rührender Sohnesliebe gibt der Troianer Aenaeas[17], der seinen greisen Vater schulternd und den Sohn an der Hand führend die brennende Stadt verlässt.
Bild 5. Terrakottagruppe aus Pompeji
(nach von Rohden 1880, 48 f. Taf. 37 a)
Wir haben gesehen, dass Alterszüge einer hochgestellten Frau wie Hekabe, der Gemahlin des Priamos, nicht zukommen. Auch Heroen altern nicht. Während Homer wortreich schildert, wie die Göttin Athena den Odysseus aus taktischem Kalkül in einen alten Mann verwandelt,
„Sprach‘s und berührte ihn mit dem Zauberstabe, Athene,
Und ließ schrumpfen die schöne Haut der geschmeidigen Glieder,
Tilgte am Haupte die braunen Haare und legte dann ringsum
Ihm um all seine Glieder die runzlige Haut eines Greises.
Und sie machte die Augen ihm trüb, die früher so schönen;
dass du unansehnlich erscheinst“ …[18]
behält der Heros in der bildlichen Darstellung sein jugendliches Aussehen.
Bild 6. Eurykleia bei der Fußwaschung
(nach Furtwängler – Reichhold 1904, Taf. 142; Pfisterer-Haas 2009, Abb. 25)
Die Amme Eurykleia ist seit der Abreise des Odysseus ebenfalls um 20 Jahre gealtert. Graues Haar und ein faltiger Hals legen Zeugnis davon ab. Darstellungen von Alterszügen, die man bei Heroen möglichst vermeidet, sind bei Dienerinnen statthaft. Während der Fußwaschung erkennt Eurykleia ihren Herrn an einer alten Narbe. Odysseus kann sie gerade noch daran hindern, in ihrer Begeisterung sein Inkognito zu verraten.
„Mütterchen, willst du mich denn verderben? Du hast mich an deiner
Brust doch selber gestillt; nach viel überstandenen Mühen
Kam ich im zwanzigsten Jahr zurück ins Land meiner Väter.“[19]
Frauen, die von ihrer Hände oder anderer Körperteile Arbeit leben, wurden ohne Weiteres realistisch, als hässlich, alt, verkommen, dargestellt. Unter den negativ konnotierten Eigenschaften, die man alten Frauen – und zwar nicht nur Hetären und Dienerinnen, sondern auch alten Bürgerinnen[20] – zuschrieb, war am häufigsten die übermäßige Liebe zum Wein, ein beliebter Topos seit spätarchaischer Zeit bis in die Spätantike, sowohl in der Literatur als auch in der darstellenden Kunst[21]. Schilderungen weiblicher Trunksucht erregten gleichermaßen Heiterkeit und Verachtung.
„Von jenem Myron, der als Bronzebildner berühmt ist, steht eine alte Betrunkene (anus ebria) in Smyrna“[22]. Das hellenistische Werk des 3. Jhs. v. Chr. ist in römischen Kopien des 1. und 2. Jhs. n. Chr. überliefert.
Bild 7. Trunkene Alte, Rom Bild 8. Trunkene Alte, München
Kapitolinische Museen Glyptothek
(Photos Verf.)
Die alte Frau hockt auf der Erde, eine bauchige Weinflasche (Lagynos) liebevoll, als wäre sie ein Kind, in den Armen haltend. Der angehobene Kopf ist haltlos zur Seite gesunken, der Mund – lallend vermutlich – geöffnet. Tiefe Furchen durchziehen die schlaffen Wangen. Mit unbarmherzigem Verismus[23] hat der Bildhauer Muskelstränge, Schlüsselbeine und Rippen unter der papierdünnen Haut des abgezehrten Körpers wiedergegeben. Die umfangreiche Flasche und das Niedersitzen am Boden deuten möglicherweise auf eine Teilnehmerin an den Lagynophorien hin[24]. Eine Efeuranke, die als plastisches Relief die Schulter des Gefäßes schmückt, weist in den Bereich des Weingottes. War die alte Säuferin in ihren besseren Jahren eine Priesterin des Dionysos[25] oder eine betagte Nymphe, „das heißt eine dionysische Amme“[26]? Im Haltungsmotiv einen Rückgriff auf den Typus des spreizbeinig hockenden Satyrn zu sehen[27] kann im Hinblick auf die beiden großplastischen Marmorfiguren nicht befriedigen, denn die Sitzende hält trotz der verlorenen Kontrolle über Mimik und Halsmuskulatur ihre Beine schicklich gekreuzt (Bild 7). Anders als die zahlreichen Terrakottastatuetten und figürlichen Gefäße, die lediglich das beliebte Thema der trunksüchtigen Vettel reflektieren, lassen die Marmorstatuen weitere bedeutsame Details erkennen: das sorgfältig geknüpfte Kopftuch und die elegante Drapierung der fein gefältelten stoffreichen Gewänder. Der herabgeglittene Träger, ein aphrodisisches Entblößungsmotiv[28], legt jedoch statt einer wohlgeformten, die Sinne stimulierenden Rundung von Schulter und Busen den kachektischen Oberkörper einer völlig heruntergekommenen Alten frei (Bild 8).
Für Dichter und Philosophen sind Zeichen des Alters und der Hässlichkeit kein Manko. Sie treten bereits in klassischer Zeit in Form von Stirnglatze, Runzeln und schlaffen Hautpartien auf. Wir begnügen uns mit dem Beispiel des sog. Hesiod und seinem faltigen Hals.
Bild 9. „Hesiod“, Neues Museum Berlin
(Photo Verf.)
Welches Kraut ist gegen das Alter gewachsen? Medea, die Zauberin aus Kolchis, weiß Rat. Sie demonstriert die Verjüngung eines Widders und verführt damit die Töchter des Pelias, ihren Vater zu zerstückeln und zu kochen, damit er mit Hilfe ihrer magischen Kräuter dem Kessel als ein Jüngerer entsteige. Die Tragödie nimmt ihren Lauf.
Bild 10. Marmorrelief um 100 v. Chr. Berlin (Photo Verf.)
Aristoteles betrachtet, wie wir gehört haben, das Phänomen des Alterns als eine Art Austrocknungsprozess. Folgerichtig behandelt später Galen mit befeuchtenden und wärmenden Mitteln. Dazu gehöre der Wein, der für alte Menschen das Beste sei (V 5). Wichtig sind diätetische Maßnahmen und die Ausfuhr (V 9), auch körperliche Übungen und sogar Stimmübungen (V 10). In den hippokratischen Schriften wird, wenn die Menschen die 50 überschritten hätten, vor plötzlicher Sonneneinstrahlung oder Abkühlung gewarnt. Dies alles sind prophylaktische Ratschläge. Als Therapie taugen sie wenig, allenfalls tragen sie ein wenig zur Linderung bei. Gegen den Tod und das Alter ist nicht anzukommen. So wie heute versucht man auch damals, die Jugend mit Hilfe der Kosmetik festzuhalten. Aus dem Orient stammen Duftstoffe. Falten werden mit Bleiweiß und Schminke abgedeckt[29].
Es ist bereits angeklungen, dass man die unnützen Alten auf ihr nahendes Ende verwies. Dazu gab es gelegentlich sehr direkte Beihilfe, zu allen Zeiten und an allen Orten. Der Zoologe Ilja Ilijitsch Metschnikoff, der 1865 in Gießen die intrazelluläre Verdauung, später die Phagozytose entdeckte, zählt 1908 in seinen Beiträgen über das Altern[30] verschiedene ersprießliche Lösungen auf: In Melanesien ist es gebräuchlich, unnütze alte Menschen lebendig zu begraben. In Feuerland würden bei Hungersnot zuerst die alten Frauen getötet und verspeist, danach die Hunde, denn diese fangen Robben, die alten Weiber aber nicht. Er verweist auch auf Dostojewskis Roman Schuld und Sühne, in dem ein altes dummes, böses Weib, das keinem Menschen das Geringste bedeute, ohne irgendwelche Gewissensbisse ermordet und beraubt werden dürfe.
Greise laufen nicht nur Gefahr, ermordet zu werden; sie entschließen sich auch leichter, ihr Leben vorzeitig zu beenden. Wie eine Statistik aus Kopenhagen ausweise, seien die Alten mit mehr als 63% an der Zahl der Suicide beteiligt[31]. Seneca, dem mit etwa 65 Jahren von seinem Kaiser und früheren Schüler Nero der Selbstmord befohlen wurde, hatte sich rechtzeitig mit diesem Thema auseinandergesetzt. Er begrüßt die Möglichkeit, das Ende selbst herbeizuführen: und “danken wir dem Gott, dass niemand im Leben festgehalten werden kann“[32].

Bild 11. Büste des Seneca, Neues Museum Berlin
(Photo Verf.)
Eine Doppelbüste zeigt ihn zusammen mit Sokrates, der ebenfalls von Staats wegen, im demokratischen Athen, den Schierlingsbecher leeren musste.
Werfen wir zum Schluss noch einen Blick auf Kindheit und Jugend, den frühen Stufen des Alters.
Bild 12. Der kleine Herakles als Schlangentöter Bild 13. Ganswürger
Rom, Kapitolinische Museen München, Glyptothek (Photos Verf.)
Berechtigen diese kleinen Lieblinge nicht zu den schönsten Hoffnungen?
Abgekürzt zitierte Literatur und Bildnachweis:
Alter in der Antike 2009: Alter in der Antike. Die Blüte des Alters aber ist die Weisheit. Katalog zur Ausstellung im LVR-LandesMuseum Bonn 25.2.2009-7.6.2009
De Beauvoir 1978: S. de Beauvoir, Das Alter (Reinbek bei Hamburg 1978)
Brandt 2002: H. Brandt, Wird auch silbern mein Haar. Eine Geschichte des Alters in der Antike (München 2002)
Furtwängler – Reichhold 1904: A. Furtwängler – K. Reichhold, Griechische Vasenmalerei. Auswahl hervorragender Vasenbilder (München 1904)
Gutsfeld – Schmitz 2009: A. Gutsfeld – W. Schmitz (Hrsg.), Altersbilder in der Antike. Am schlimmen Rand des Lebens? (Göttingen 2009)
Herrmann-Otto 2004: E. Herrmann-Otto (Hrsg.), Die Kultur des Alterns (St. Ingbert 2004)
Kunze 1999: Chr. Kunze, Verkannte Götterfreunde, Römische Mitteilungen 106, 1999, 69-77
Lippold 1950: G. Lippold, Die griechische Plastik. Hellenistische Periode, Hochblüte des 3. Jahrhunderts, Handbuch III 1(München 1950) 322
Neugebauer 1951: K. A. Neugebauer, Die griechischen Bronzen der Klassischen Zeit und des Hellenismus (Berlin 1951)
Pfisterer-Haas 2009: S. Pfisterer-Haas, Ammen und Pädagogen, in: Alter in der Antike, Bonn 25.2.2009-7.6.2009, 69-80 Bild 6
Von Rohden 1880: H. von Rohden, Die Terrakotten von Pompeji (Stuttgart 1880) Bild 5
Salomonson 1980: J. W. Salomonson, Der Trunkenbold und die Trunkene Alte, BaBesch 55, 1980, 65-106 Taf. 107-135
Simon 1981: E. Simon, Die griechischen Vasen (München 1981) Bild 2-4
Simon 2004: Kourotrophoi, in: S. Bergmann – S. Kästner – E.-M. Mertens (Hrsg.), Göttinnen, Gräberinnen und gelehrte Frauen (Münster – New York – München – Berlin 2004)
Wrede 1991: H. Wrede, Matronen im Kult des Dionysos, Römische Mitteilungen 98, 1991, 163-188
Zanker 1989: P. Zanker, Die Trunkene Alte. Das Lachen der Verhöhnten (Frankfurt am Main 1989)
Antike Literatur:
Il.: Homer, Ilias. Übers. R. Hampe (Stuttgart 22007)
Od.: Homer, Odyssee. Übers. R. Hampe (Stuttgart 22007)
Plin. nat.: C. Plinius secundus d. Ä. Naturkunde Buch 26, 1-5. Lateinisch-deutsch (München 1979)
Sappho: Sappho, Lieder, griechisch und deutsch (M. Treu Hrsg. München 1958)
Verg. Aen.: Vergil, Aeneis. Übersetzt und herausgegeben von W. Plankl, unter Verwendung der Übertragung Ludwig Neuffers (Stuttgart 32005)
[1] Herrmann-Otto 2004, 14.
[2] Seneca, Brief 108, an Lucilius 28; den Hinweis verdanke ich Prof. Dr. K. D. Fischer, Mainz.
[3] De generatione animalium V 4.784 b 32-34, zit. nach G. Wöhrle, Der alte Mensch im Spiegel der antiken Medizin, in: Herrmann-Otto 2004, 19-31.
[4] Sappho 4, 65 a D. 13-15; 1, 12 D.
[5] Abbildung mit freundlicher Erlaubnis von Frau Dr. E. van der Meijden Zanoni, Basel.
[6] Zit. nach Brandt 2002, 33.
[7] Il. 4, 313.
[8] Il. 22, 71-75.
[9] Sprüche Salomonis Kap. 16 Vers 31, nach dem Hinweis bei S. de Beauvoir 1978, 79 und 95.
[10] Solon Frgm. 22,7, Diehl, zit. bei Brandt 2002, 37.
[11] Il. I, 249.
[12] Il. 4, 320-323.
[13] Für wiederholt erteilte Abbildungserlaubnis bin ich Frau Prof. Dr. Erika Simon, Würzburg, von Herzen dankbar.
[14] Il. 22, 395 f.
[15] Christa Wolf, Kassandra (Frankfurt am Main 2008) 33. 51. 69. 86. 87. 88. 93. 97. 117.124.125.127.129.142.
[16] Il. 24, 515.
[17] Verg. Aen. 2, 705-725.
[18] Od. 13, 429-433.
[19] Od. 19, 482-484.
[20] Pfisterer-Haas 1989, 78.
[21] Pfisterer-Haas 1989, 78; Salomonson 1980, 94-97; s. sprechende Namen wie οινοϕίλη für das Bild einer Alten mit Weinschlauch auf einem attischen Gefäß in London, Pfisterer-Haas 78, oder „Silenis“ in einem Spott-Epigramm, Salomonson 96, bekunden die Nähe zu Trunk und dionysischem Gefolge.
[22] Plin. nat. 36, 33; zu Myron, möglicherweise ein hellenistischer Meister, der denselben Namen trägt wie der berühmte Skulpteur des 5. Jhs. v. Chr.: Zanker 1989, 82; zur etl. fehlerhaften Überlieferung des Künstlernamens Salomonson 1980, 96 Anm. 171.
[23] Neugebauer 1951, 71.
[24] Ein Fest, das von Ptolemaios IV in Alexandria eingerichtet worden war, Kunze 1999, 72 f; Pfisterer-Haas 1989, 83..
[25] Lippold 1950, 322; Salomonson 1980, 96 Anm. 170; Wrede 1991, 173.
[26] Simon 2004, 72 f. Abb. 1-2.
[27] Kunze 1999, 77.
[28] Zanker 1989, 61.
[29] Alter in der Antike 2009, 173 f.
[30] E. Metschnikoff, Beiträge zu einer optimistischen Weltauffassung (München 1908) 9-12.
[31] Metschnikoff a. O.
[32] Seneca, De senectute 12, 10, zit. nach Brandt 2002, 195.
Der Aufsatz ist erschienen in dem Buch Wamser-Krasznai: Fließende Grenzen – Zwischen Medizin, Literatur und (antiker) Kunst), Minerva Verlag, Budapest, 2015. Der Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Verlags.
-
Zur Ikonodiagnostik[1] antiker Bildwerke
Die Bilder von tönernen Gliedmaßen mit „Effloreszenzen“ sind wohlbekannt. Es handelt sich um ein Knie und einen Ellenbogen mit flachen, runden Erhebungen, die man unter anderem als Pusteln[2] oder Psoriasis[3] gedeutet hat.
Bild 1 Terrakottafragmente
(nach Holländer 1912, Abb. 201. 202)Den Ellenbogen fand 1895 Luigi Sambon auf einem Schutthaufen beim Museum des Botanischen Gartens in Rom[4], ganz in der Nähe des Heiligtums der Minerva Medica. Dort kam auch ein gleichartiges Knie zu Tage[5]. Psoriasis und „ähnliche“ Krankheiten seien den Alten unter dem Namen Lepra bekannt gewesen. Das bedeute Rauigkeit und sei nicht mit „leprosy“ (unserem heutigen Krankheitsbegriff Lepra) zu verwechseln[6], kommentiert er seinen Fund.
Holländer, der im Allgemeinen nicht für seine Zurückhaltung bekannt ist, wenn es gilt, retrospektive Diagnosen zu stellen, vergleicht die beiden Extremitätenfragmentemit dem fellartigen Integument eines Silens aus der Villa Albani in Rom.
Bild 2. Silen, Rom Villa Albani
(nach Holländer 1912, Abb. 203)Angesichts der „rundlichen Erhabenheiten“ könne man sich kaum vorsichtig genug äußern[7]. „Die rauhe Haut … solcher Waldmenschen … hat hier den ganzen Körper überzogen. Fände man einen solchen Ober- und Unterschenkel isoliert, so ist die pathologische Diagnose fertig.“ Auch Grmek und Gourevitch halten die Gliedmaßen für Körperteile eines Satyrn, relativieren diese Einschätzung aber durch den Hinweis auf die Bedeutung des Fundorts, eben das Votiv-Depot einer Heilgottheit[8]. Rein optisch drängt sich beim Anblick der flachen Plaques eher das Bild einer Borderline-Lepra auf als der Vergleich mit dem Fell eines Silens.
Bild 3. Borderline-Lepra (nach G. Rassner[9], 93 Abb. 7.45)
Hier ist der Ort für einen Exkurs vom Bildwerk zu den antiken Schriftquellen.
In seinen „naturalis historiae“ äußert sich Plinius der Ältere zu den unterschiedlichen, die Haut nachhaltig verändernden Krankheitsbildern, die offenbar innerhalb von zwei verschiedenen Zeitabschnitten nach Italien eingeschleppt wurden[10]: „Das menschliche Gesicht wurde von neuen … Krankheiten befallen, die sich nirgendwo so stark ausbreiteten „als in Rom und seiner Umgebung; sie traten zwar ohne Schmerz oder Lebensbedrohung auf, waren aber so entstellend, dass jede andere Todesart vorzuziehen war. Die schwerste von ihnen hat man mit dem griechischen Namen leichen (Flechte) bezeichnet, im Lateinischen …, da sie zumeist am Kinn ihren Anfang nahm, “als „Kinnkrankheit“ – mentagra[11]. Sie habe sich „erst in der Mitte der Regierung des Kaisers Tiberius Claudius … in Italien“ eingeschlichen, wobei sie sich auf das Gesicht, „Hals, Brust und Hände“ ausbreitete, … „die Haut mit scheußlichen Schuppen bedeckend.“
Andererseits fand „man zur Zeit Pompeius‘ des Großen durch den zufälligen Versuch (eines Betroffenen) … der sich aus Scham das Gesicht“ mit den zerkauten Blättern der wilden Minze bestrich, ein Mittel gegen Elephantiasis graecorum, die Knotenlepra[12], bei der sich „… unter der Haut und den Schleimhäuten harte Knoten bilden, die später weich werden und in zerstörende Geschwüre übergehen“[13]. Minzeblätter scheinen bereits um 60 v. Chr. als Therapie gegen Elephantiasis oder Knotenlepra[14] angewandt worden zu sein. Der Begriff „ λειχήνες“ taucht erst um 26 n. Chr. auf. Im Übrigen gebe es neben der Lesart „pudorem“ (aus Scham) noch eine weitere, nämlich „putorem“ (wegen des üblen Geruchs)[15].
In den Choephoren des Aischylos bedroht der delphische Apollon den Sohn des Agamemnon, Orest, mit dem Befall durch Aussatz, λειχήνες, falls er sich der Pflicht, den Mord an seinem Vater zu rächen[16], entziehe.
Aus den Fragmenten des Hesiod erfahren wir etwas mehr über die Symptome: … „die Gottheit goss ihnen schreckliche Krätze über ihre Häupter. Aussatz ergriff ihren ganzen Leib; ihr Haar fiel aus und ihre hübschen Köpfe wurden kahl“[17].
Das deutsche Wort Aussatz steht für griechisch αλφός, lateinisch albus, was so viel bedeutet wie weiße Hautflecken, Leukoderma. In der Tat führt die Lepra nicht selten zu Hypo-Pigmentierungen und auch zu Haarausfall. Doch in die kahlen Stellen auf den Köpfen antiker Terrakottafiguren eine Alopezie hineinzudeuten sei ferne, denn es handelt sich lediglich um die banale Folge des mechanischen Abriebs[18]. Manchen tönernen Exemplaren ist anzusehen, dass sie sich aus Teilstücken zusammensetzen, die jeweils von verschiedenen Matrizen (Modeln) abgeformt sind. Nach dem Verstreichen der Übergänge können dann Haarsträhnen oder ornamentale Hakenlocken (Bild 4) angefügt werden.
Bild 4. Frauenkopf vom Quirinal, Rom
(nach Holländer 1912, S. 304 Abb. 196)Die Seuche, so geht es bei Plinius weiter, „verbreitete sich dann aber auch auf Hals, Brust und Hände, die Haut mit scheußlichen Schuppen (furfure) bedeckend[19]“.
Bild 5. Büstenfragment aus Cales
(nach Holländer 1912, 303 Abb. 195)Ein aus Cales in Kampanien stammender bärtiger Terrakottakopf mit Büstenansatz (Bild 5) lässt, wenn man ihn vom Ästhetischen her betrachtet, manches – um nicht zu sagen alles – zu wünschen übrig. Ob der Koroplast eine Büste herstellen wollte oder ob das Stück zu einer Halbfigur bzw. einer ganzen Statuette gehört, bleibt offen; das Fragment reicht aus, den Spekulationen um verschiedene Krankheitsdiagnosen Raum zu geben: Sykosis barbae[20], Pocken[21] und die „mentagra – Kinnkrankheit“ der alten Autoren[22]. Trotz der rohen barbarischen Ausführung[23] entspricht die Art der Applikation von Tonpartikeln im Prinzip derjenigen des oben besprochenen Frauenkopfes. Haare und Bart sind als Teilchen von unterschiedlicher Form und Größe nachträglich angefügt, ebenso wie die Reihe kammartig nach oben gerichteter Borsten über der Stirn. Als klobige Trennwand ist die Nase zwischen die dreieckigen Augen gesetzt. Für die bandförmig angeordneten ‚Plaques‘ im Bereich des Halses und der Brust hat man eine andere Technik angewendet. Die rundlichen Markierungen wurden offenbar in den Tongrund hinein ‚gestanzt‘. Ist Behaarung damit gemeint? Durch die willkürliche Anordnung der flachen runden Stanzlöcher wird die Deutung erschwert. Nun steht die kuriose Schöpfung nicht ganz allein in der koroplastischen Landschaft. Das archäologische Museum Bergamo bewahrt in seinen Sammlungen eine vergleichbare Terrakottabüste unbekannter Herkunft auf[24]. Bänder aus runden Stanzlöchern kreuzen sich auf der Brust. Derartige „Kreuzgürtungen“ auf scheinbar nackter Haut dienten vermutlich als Metapher für Schmuck und Bekleidung. Lepra werden wir jedoch weder im einen noch im anderen ‚Fall‘ diagnostizieren! Gerade die Augenregion ist beim Kopf aus Cales frei von Affektionen; sogar die Wimpern sind erhalten. Es bleiben noch die kleinen Ohren, die zu hoch sitzen und nach vorn geklappt sind, doch macht das ihren Eigentümer noch nicht zu einem verletzten Faustkämpfer. Auf Grund der Technik und der ausgeprägten Stilisierung ist zu vermuten, dass die Büste in Bergamo ebenso wie der Kopf aus Cales in Kampanien entstand, einer Landschaft mit ganz eigenwilligen künstlerischen Ausdrucksformen, die sich nur ausnahmsweise an griechischen Schönheitsidealen orientieren. Den kampanischen Kunsthandwerkern und ihrem Kundenkreis lag anscheinend Expressivität mehr am Herzen als glatte Ästhetik.
Für den Verlust der Nasenspitze endlich (Bild 5) ist kein anderes schleichendes Übel verantwortlich als der Zahn der Zeit.
Der Kuriosität halber sei noch ein kleiner Exkurs nach Zypern angeschlossen.
Bild 6. Weibliche Brust mit Traube, Zypern
(nach Holländer 1912, 300 Abb. 192)Dort entstand für das Heiligtum von Golgoi ein Kalksteinrelief mit Brüsten (?) und einem traubenartigen Gegenstand. Dieser galt, vor allem ohne den Stiel, den Sambon bei seiner Umzeichnung weggelassen hatte, als proliferatives Karzinom oder alsAktinomykose der Brust[25]. Tatsächlich ist aber eine Weintraube wiedergegeben, in einer durchaus ungewöhnlichen Kombination mit weiblichen Brüsten – falls diese Deutung denn Stand hält. Gerade die mutmaßliche Mammillen- (Brustwarzen-) Region beider Seiten ist nämlich beschädigt.
Angenommen, es handelt sich wirklich um Brüste, was könnte dann den Verfertiger des Votivs zu einer so ausgefallenen Zusammenstellung veranlasst haben? Wollte er sich die Heilgottheit in besonderer Weise gewogen machen, indem er sie außer mit einem Brustvotiv noch mit einem weiteren Fruchtbarkeitssymbol, einer Traube, erfreute?
Oder hat er gar nicht Brüste wiedergegeben, sondern eine Platte mit Früchten und – vielleicht – Cerealien?Eines jedenfalls ist sicher: Auch hier handelt es sich nicht um eine Darstellung der Lepra!
Bildnachweis und abgekürzt verwendete Literatur:
Aisch. Ch.: Aischylos, Choephoroi, in: Aischylos, Tragödien. Übersetzt von O. Werner. (Düsseldorf – Zürich 2005)
Baggieri 1996: G. Baggieri – M. L. Rinaldi Veloccia, “Speranza e Sofferenza” nei votivi anatomici dell’Antichità (Rom 1999)
Bonghi Jovino 1965: M. Bonghi Jovino, Terrecotte votive. Teste isolate e mezzeteste. Capua preromana I (Florenz 1965)
Ciaghi 1993: S. Ciaghi, Le terrecotte figurate da Cales del Museo Nazionale di Napoli (Rom 1993)
Gatti lo Guzzo 1978: L. Gatti lo Guzzo, Il deposito votivo dall’ Esquilino detto di Minerva Medica (Florenz 1978)
Grmek – Gourevitch 1998: M. Grmek – D. Gourevitch, Les Maladies dans L’Art antique (Poitiers1998)
Guzzo – Moscati – Susini 1994: P. G. Guzzo – S. Moscati – G. Susini, Antiche genti d’Italia (Rom 1994)
Holländer 1912: E. Holländer, Plastik und Medizin (Stuttgart1912) Bild 1 und 2 sowie 4-6.
Karageorghis 2003: V. Karageorghis, The Cyprus Collections in the Medelhavsmuseet Stockholm (Nicosia 2003)
Laser 1983: S. Laser, Medizin und Körperpflege, in: H.-G. Buchholz (Hrsg.), Archaeologia Homerica (Göttingen 1983)
C. Martini 1990: C. Martini, Il Deposito Votivo del Tempio di Minerva Medica (Rom1990)
Ongaro 1978: G. Ongaro, Tre Ex Voto Romani di interesse dermatologico, Chron. Derm. IX 6/1978, 749-754
Plin. nat.: C. Plinius secundus d. Ä. Naturkunde Buch 26, 1-5. Lateinisch-deutsch (München 1979) 12-17. 210-213
Rassner 82006: G. Rassner, Dermatologie (München 2006) Bild 3
Sambon 1895: L. Sambon, Donaria of Medical Interest, The British Medical Journal 1895, 2 146-150. 216-219
[1] Für eine Fragestellung, bei der das Bild ganz im Vordergrund steht, eignet sich die Bezeichnung „Ikonodiagnostik“ besser als der Begriff der retrospektiven Diagnose, s. Grmek – Gourevitch 1998, 27 f.
[2] „Pustole“, Gatti Lo Guzzo 1978, 139 S 8 Taf. 52; ebenso C. Martini 1990, 19 Abb. 10 b.
[3] „verosimilmente affetto da psoriasi“, Ongaro 1978, 751 Abb. 1 und 2.
[4] Sambon 1895, 216 f. Abb. 11.
[5] Gatti Lo Guzzo 1978, 139. Nr. 8 Taf. 52.
[6] „Psoriasis and other similar diseases were known to the ancients by the name of lepra, which meant roughness, and must not be confounded with leprosy“, Sambon 1895, 217.
[7] Holländer 1912, 307-309 Abb. 201-203.
[8] Grmek – Gourevitch 1989, 344 f. Abb. 273. 274.
[9] G. Rassner, Dermatologie (München-Jena 82006). Ich danke dem Autor herzlich für die freundliche Genehmigung zur Publikation der Abbildung..
[10] Plin. nat. 26, 3. 3.
[11] Plin. nat. 26, 1. 2.
[12] Plin. nat. 20, 144.
[13] Erläuterungen zu Plin. nat. 20, 109, S. 229-230.
[14] Nicht zu verwechseln mit der tropischen „Elephantiasis Arabum, gekennzeichnet durch unförmiges Anschwellen … der Extremitäten“, die durch einen Fadenwurm verursacht wird, Erläuterungen zu Plin. nat. 20, 109 S. 229-230.
[15] Erläuterungen zu Plin. nat. 20, 144 S. 247.
[16] Aisch. Ch. 270-285; Laser 1983, S. 84 f. mit Anm. 212. 213.
[17] Hes. Fr. 28 Rz, zit. nach Laser 1983, S 84 ϑ; Ps. Plut., de fluv. 21, 4.
[18] Außer unserem Bild 4 s. auch Votivkopf aus Capua, mit applizierten, heute zum Teil verlorenen (abgeriebenen) Haarsträhnen, Bonghi Jovino I, 1965, 84 Taf. 39. 1. 2.
[19] Plin. nat. 26, 2. 2.
[20] Holländer 1912, 304; Ongaro 1978, 753 Abb. 6.
[21] Baggieri 1996, 38, Abb. 3; „äußerst unwahrscheinlich“, Grmek – Gouerevitch 1998, 347.
[22] Grmek – Gouerevitch 1998, 347 Abb. 276.
[23] Ciaghi 1993, 253 f. Abb. 180.
[24] „Busto di Orobio“, Guzzo – Moscati – Susini 1994, 260 Abb. 741.
[25] Grmek – Gourevitch 1998, 322 f. mit Anm. 60-62 Abb. 257.
Der Aufsatz ist erschienen in „Fließende Grenzen – Zwischen Medizin, Literatur und (antiker) Kunst, Minerva Verlag Budapest,2015. Der Abdruck hier erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Meinerva Verlags.
-
Die Darstellung echter Krankheitszeichen bei antiken Bildwerken ist eine Rarität, lange nicht so häufig, wie wir Ärzte, Medizinhistoriker und manchmal auch Archäologen mit unserer retrospektiven Diagnostik es gern hätten. Gleichwohl begegnen uns gelegentlich Darstellungen, die wir vorsichtshalber nicht pathologische Befunde, sondern
1. Abweichungen von der Norm
nennen wollen. Da gibt es die
a. numerische Aberration, also eine quantitative Abweichung von der Norm.
Abb. 1 Linker Vorfuß, Corvaro/Latium, 3./2. Jh. v. Chr.
(nach L. Capasso 1999, 31 Abb. E 0.2)
Hier ist ein Fuß mit sechs Zehen wiedergegeben. Hat der Koroplast (Tonbildner) wirklich eine Polydaktylie darstellen wollen[1], oder handelt es sich um ein Versehen, eine Unachtsamkeit des Kunsthandwerkers? Liegen rituelle Gründe vor? Haben wir es mit dem Fragment einer Figur oder eines Votivfußes zu tun? Viele offene Fragen!
Etwas anders liegt der Fall bei einem Fuß aus Praeneste, dem heutigen Palestrina. Die überzählige sechste Zehe ist deutlich kürzer und offenbar nicht vollständig von der fünften getrennt. Man gewinnt den Eindruck, daß es dem Koroplasten, der etwas Ähnliches aus eigener Anschauung am Lebenden gekannt haben mag, tatsächlich um die Darstellung einer Normabweichung ging.
Abb. 2 Praeneste/Palestrina, frühe römische Kaiserzeit
(nach M. Grmek – D. Gourevitch 1998, 289 f. Abb. 227)
Noch weniger häufig ist die
b. qualitative Aberration.
Ein um 2000 v. Chr. auf Kreta entstandenes Terrakottafigürchen zeigt eine beträchtliche Umfangsvermehrung des linken Beines.
Abb. 3 Lipoedem (?) aus einem Höhenheiligtum auf Kreta, um 2000 v. Chr.
(nach M. Grmek – D. Gourevitch 1998, 293 Abb. 230)
Offensichtlich ist die Veränderung einseitig. Man denkt an ein Krankheitsbild aus dem Umkreis Lymphoedem, Lipoedem, Elephanthiasis, Papillomatosis cutis lymphostatica, die allerdings an den Beinen häufiger doppelseitig auftreten. So läßt sich denn auch ein „Ausreißer“, eine Fehlform, wie sie in jeder Werkstatt passieren können, nicht völlig ausschließen.
Im 7. Jh. v. Chr. konnten die Pferdemenschen, Kentauren, sowohl mit männlichen als auch mit weiblichen Geschlechtsmerkmalen dargestellt werden; nicht als Dokumentation eines hermaphroditischen Irrwegs der Natur, sondern als Ausdruck des Dämonischen, das all diesen Mischwesen innewohnt.
Abb. 4 Ayia Irini/ Zypern 7. Jh. v. Chr. Meddelhavsmuseet Stockholm
(nach V. Karageorghis 2003, 164 f. Nr. 190)
2. Abstraktionen und Stilisierungen
Naturgetreue Formen können landschaftsspezifisch abstrahiert oder zeitbedingt stilisiert sein. Den bewußten Abweichungen von der physiologischen Anatomie des Menschen kommt bisweilen nicht der geringste Krankheitswert zu. Die Angabe eines zusätzlichen vierten Gliedes am fünften Finger ist durchaus nicht als pathologisch zu verstehen, sondern als eine
a. spezifisch regionale Gestaltungsweise[2].
Man bediente sich ihrer bei den Kouroi, überlebensgroßen marmornen Jünglingsfiguren archaischer Zeit, und zwar ausschließlich in der Landschaft Attika. Streng parallel und ganz naturwidrig liegen die Finger nebeneinander. Es ist eine reine Kunstform.
Abb. 5 Sunion, Kuros A , frühes 6. Jh. v. Chr. (nach W. Martini 1990, 130 Abb. 37)
Auch andere Körperteile hat man vorsätzlich verändert, abstrahiert. Die Ohrmuschel des Kouros A ist vollkommen vertikal gegeben, mit ornamentalen Windungen, parallel verlaufender Helix und Anthelix und einem übergroßen kugelrunden Tragus[3].
Abb. 6 Sunion, Kuros A , frühes 6. Jh. v. Chr. (nach W. Martini 1990, 18. 204 Abb. 3
b. zeitgebundene Stilisierung
Nicht auf Attika beschränkt ist die Vermehrung der naturgegebenen vier Abdominalmuskel-Kompartimente auf sechs bei archaischen Männerfiguren. Beim attischen Kuros A von Sounion wirkt die lineare Sechsteilung der Bauchwand vollkommen graphisch.
Abb. 7 Sounion, Kouros A, frühes 6. Jh. v. Chr. (nach W. Martini 1990, 118 f. Abb. 34)
Dagegen stellt der Koroplast aus einer Werkstatt in Tarent (Westgriechenland) die sechs Kompartimente des geraden Bauchmuskels als plastisch gewölbte, durch tiefe Einziehungen von einander abgesetzte, ‚Kissen‘ dar.
Abb. 8 Tarentiner Symposiast, Neapel (nach A. Levi 1924, 26 f. Abb. 28)
Die ebenfalls noch in archaischer Zeit entstandene Terrakottafigur zeigt einen Symposiasten, einen zum Bankett gelagerten jungen Mann[4].
Mehr als eine Generation später, in klassischer Zeit, halten sich die Skulpteure eher an die anatomischen Gegebenheiten. Eine römische Kopie der um 440/430 v. Chr. geschaffenen Statue des Diomedes lässt das Relief der vorderen Bauchwand mit den vier durch Faserplatten verbundenen Kompartimenten des Musculus rectus abdominalis erkennen.
Abb. 9 Statue ca. 440 v. Chr. (nach A. Benninghoff – K. Goerttler 1957, 162 Abb. 102)
Der Kuriosität halber folgen einige Beispiele von retrospektiven Diagnosen, die nur als
3. Fehlinterpretationen bezeichnet werden können.
Abb. 10 Reibfinger aus Marmor (nach E. Holländer 1912, 306 f. Abb. 198)
Die Beugestellung des Fingers verlockt dazu, an eine Kontraktur des Mittelgelenks oder an einen schnappenden Finger, digitus saltans, zu denken. Doch sind diese beiden Krankheitsbilder nicht gravierend und nicht häufig genug, um eine solche Fülle von Darstellungen erwarten zu lassen wie die Ausgrabungen im gesamten Mittelmeerraum ergaben. Mitfunde von Reibschalen unterstützen die Deutung als Reibfinger, eine Art von kleinen Mörserkeulen, in der „üblichen, einem gebogenen Daumen ähnlichen“ Form[5]. Sie bestehen aus Basalt, Marmor oder Kalkstein und wurden zum Reiben von Salben, Schminke und dergleichen verwendet.
Abb. 11 Terrakottafigur aus Ayia Irini/Zypern, Anf. 6. Jh. v. Chr.
(nach V. Karageorghis 1993, 27 Nr. 66 Taf. 18, 1)
Für einen angehenden Unfallchirurgen ist es gewiss verlockend, in der zyprischen Männerstatue einen Soldaten zu sehen, „der seinen gebrochenen Arm mittels eines Bandes um den Hals in rechtwinkliger Beugung im Ellenbogengelenk hält, wobei der Unterarm in einer Mittelstellung zwischen Pronation und Supination steht“[6]. Dieser „Soldat“ ist jedoch kein Einzel-‚Fall‘. Er gehört zur großen Gruppe männlicher Gewandfiguren aus Kalkstein oder Ton, die auf Zypern seit der Mitte des 7. Jhs. und im 6. Jh. v. Chr. in Heiligtümer geweiht wurden[7]. Für das Motiv des gebeugt eingehüllten rechten Armes, verbunden mit dem Gestus der zur Faust geballten Hand hat man bisher noch keine wirklich überzeugende Deutung gefunden[8]. Die Interpretation als Gebets- oder Verehrungsgestus[9] kann schon deshalb nicht völlig befriedigen, weil es auch männliche Statuen mit dem traditionellen Gruß- oder Gebetsgestus gibt, nämlich dem erhobenen rechten Unterarm und der nach vorn gerichteten offenen Hand[10].
Einen besonders reizvollen ‚Fall‘ versuchte man in die „Statue eines jungen, bildschönen armverletzten römischen Mädchens“ hineinzudeuten[11]. Doch der Mantelbausch, der den linken Arm umhüllt, sollte nicht als Armtragetuch mißverstanden werden. Es handelt sich vielmehr um ein Gewandmotiv, das die jugendliche Anmut und die kokette Haltung des sitzenden Mädchens vom Kapitol wirkungsvoll unterstreicht.
Abb. 12 Sitzendes Mädchen, Rom, Kapitolinische Museen, Anf. 3. Jh. v. Chr.
(nach Bulle 1922, 123 Abb. 171)
Bildnachweis und abgekürzt zitierte Literatur:
Benninghoff – Goerttler 1954: A. Benninghoff – K. Goerttler, Lehrbuch der Anatomie des Menschen 1 (München – Berlin – Wien 1957) Abb. 9
Bulle 1922: H. Bulle, Der schöne Mensch im Altertum (München 1922) Abb. 12
Capasso 1999: L. Capasso, Le terrecotte votive come fonti di informazioni paleopatologiche, in: G. Baggieri (Hrsg.), „Speranza e sofferenza“ nei votivi anatomici dell’Antichità (Rom 1999) Abb. 1
Grmek – Gourevitch 1998: M. Grmek – D. Gourevitch, Les maladies dans l’art antique (Poitiers 1998) Abb. 2 und 3
Holländer 1912: E. Holländer, Plastik und Medizin (Stuttgart 1912) Abb. 10
Karageorghis 1993: V. Karageorghis, The Coroplastic Art of Ancient Cyprus III (Nicosia 1993) Abb. 11
Karageorghis 2003: V. Karageorghis, The Cyprus Collections in the Medelhavsmuseet (Nicosia 2003) Abb. 4
Levi 1924: A. Levi, Le Terrecotte figurate del Museo Nazionale di Napoli (Florenz 1924) Abb. 8
W. Martini 1990: W. Martini, Die archaische Plastik der Griechen (Darmstadt 1990) Abb. 5-7
Mylonas 2003: D. Mylonas, Ikonographie und Typologie der kyprischen archaischen Kalksteinplastik, in: V. Karageorghis – S. Rogge (Hrsg.), Junge zyprische Archäologie (Münster – New York – München – Berlin 2003) 51-71
Papaxenopoulos 1981: A. Papaxenopoulos, Zypriotische Medizin in der Antike, Diss. Universität Würzburg 1981
Schadewaldt u. a. 1966: H. Schadewaldt – L. Binet – Ch. Maillant – I. Veith, Kunst und Medizin (Köln 1966) 64 f.
Schmidt 1968: G. Schmidt, Kyprische Bildwerke aus dem Heraion von Samos (Bonn 1968)
Senff 1993: R. Senff, Das Apollonheiligtum von Idalion (Jonsered 1993)
Wamser-Krasznai 2013: W. Wamser-Krasznai, Für Götter gelagert. Studien zu Typen und Deutung Tarentiner Symposiasten (Budapest 2013)
Wiegand – Schrader 1904: Th. Wiegand – H. Schrader, Priene (Berlin 1904
[1] Capasso 1999, 31 Abb. E 0.2.
[2] W. Martini, Die archaische Plastik der Griechen (Darmstadt 1990) 130. 203 f. Abb. 37.
[3] Martini 1990, 204.
[4] Levi 1924, 26 f. Abb. 28; Wamser-Krasznai 2013, 182 Nr. 437 Abb. 83.
[5] Wiegand – Schrader 1904, 393.
[6] Papaxenopoulos 1981, 21 f. Abb. 1.
[7] Senff 1993, 25. 30 Taf. 3 f. 51 d-f.
[8] […] „verschiedene kultische Gesten, die sich seit frühesten Zeiten herauskristalisiert haben […] Die Armhaltung […] ist als bestimmter religiöser Gestus zu definieren“ […], Mylonas 2003, 54 f.; […] Der Gestus […] „einer dienenden Bereitschaft“, Schmidt 1968, 103; […] „der rechte (Arm) in einer Mantelschlaufe mit geballter Faust vor die Brust genommen“ […] Senff 1993.
[9] Senff 1993, 25 Anm. 204.
[10] Senff 1993, 34 Taf. 12 g-i und 13 e-g.
[11] H. Schadewaldt – L. Binet – Ch. Maillant – I. Veith, Kunst und Medizin (Köln 1966) 64 f. Abb. 46, fälschlich „Vatikan. Museen“.
Copyright Frau Dr. Dr. Waltrud Wamser-Krasznai
-
Hephaistos – ein hinkender Künstler und Gott
Wenn es um die Behinderung des Hephaistos geht, sind die literarischen Quellen ebenso widersprüchlich wie die Zeugnisse der antiken Kunst.
Hephaistos sagt von sich: „ [..] aber ich selber kam als Krüppel zur Welt“ (Od. 8, 310).In der Ilias 18, 393-398 geht er ins Detail:
„Ihr antwortet drauf der hinkende Feuerbeherrscher:
O, so besucht mein Haus die erhabene, würdige Göttin,
die mich rettete einst nach dem schrecklichen Sturz in die Tiefe,
als mich die [..] Mutter hinab warf, welche mich Lahmen
wegzuschaffen beschloss. Trübseliges hätt’ ich erduldet,
wenn des Okeanos Tochter [..] Thetis [..] mich nicht
geborgen am Busen [..].
Sprachs, der schnaufende Ries’, und erhob sich vom Ambossklotze
hinkend, humpelte dann umher mit den schwächlichen Beinen [..]“
(Il. 18, 410-411)Abb. 1: Relief Ostia, 2. Jh. n. Chr.
Doch die einzige Darstellung, die wir von dem Sturzflug besitzen, zeigt den unwillkommenen Sohn mit wohlgeformten Füßen. Es ist ein römisches Relief aus Ostia, das den Neugeborenen als verkleinerten Erwachsenen zeigt, mit den Attributen seiner späteren Tätigkeit, Hammer und Zange.
Die Wiedergabe krankhafter Veränderungen an den Beinen beschränkt sich auf die archaische Zeit[1].
Abb. 2: korinthischer Amphoriskos, 600-580 v. Chr.
In der Klassik wird das körperliche Gebrechen nicht mehr so drastisch vorgetragen; Hephaistos sitzt z. B. mit unterstützten Füßen seitlich auf einem Esel[2]. Am Ostfries des Parthenon in Athen deutet sich die Behinderung nur mehr durch einen unter die Achsel geklemmten Stock an:
Abb. 3: Hephaistos und Athena, etwa 440 v. Chr.
Wie kommt es eigentlich zu dieser Behinderung?
Die homerischen Epen überliefern den Sturz aus dem Olymp zweimal, unter verschiedenen Umständen. Im Homerischen Hymnus an Apollon zeigt Hera ihre Enttäuschung über den krummfüßigen Sohn und schildert ihre wenig mütterliche Tat:
„Mein Sohn freilich, Hephaistos, den selbst ich gebar, ist ein Schwächling
[..] mit krummen Füßen.
Einst packt ich ihn grad an den Händen und warf ihn ins weite
Meer; doch Thetis, die silberfüssige Tochter des Nereus,
Fing ihn auf und versorgt ihn im Kreis ihrer Schwestern. “
(Hom. h. Apollon 316-320)1. Liegt demnach eine angeborene Missbildung vor? Dabei denken wir vor allem an den Klumpfuß. Dazu passt die familiäre „Fußschwäche“, die von zwei Söhnen des Hephaistos überliefert ist. Palaemonios, einer der Argonauten, hinkt wie sein Vater Hephaistos, „mit verstümmelten Füßen“ (Apoll. Rhod. Argonautika 1, 202-204. Orph. Arg. 212). Periphetes,
der Keulen tragende Sohn Vulcans (Ov. met. 7, 437; Paus. 2, 1, 4), wird von Theseus bei Epidauros erschlagen. Er war „schwach an den Füßen“ (Apollod. 1, 112 und 3, 16, 1)[3]. Auf den wenigen bildlichen Darstellungen der Hephaistos- Söhne findet sich jedoch kein Hinweis auf ein Gebrechen.Der zweite Sturz geht auf das Konto des Zeus. Er fasst den Hephaistos, der gegen ihn für Hera Partei ergriffen hatte, am Fuß und wirft ihn vom Olymp (Il.1, 590-594). Der Unglückliche ist
halbtot, als ihn die Bewohner von Lemnos, die thrakischen Sintier[4], aufnehmen und soweit möglich gesund pflegen.2. Haben wir es also mit einer posttraumatischen Behinderung zu tun? Nach Apollodorus, Valerius Flaccus und Lukianus ist die Lahmheit eine Folge des Sturzes[5].
Ein anderer Erklärungsversuch führt das Hinken des Hephaistos auf die Blessuren zurück, die sich dieser als Titan unter Titanen, im Kampf gegen die Olympier, zugezogen habe. Während die übrigen Titanen von Zeus in den Tartaros gestoßen wurden, habe Hephaistos in den Olymp zurückkehren dürfen. Zwar behalte er als Zeichen seines Sturzes die lädierten Beine, aber er werde eben doch Olympier[6]. Für diese Hypothese, die nicht ohne Reiz ist, fehlen allerdings bildliche und schriftliche Zeugnisse. Als einziger Hinweis auf die titanische Urgewalt des Gottes dient das stets betonte Missverhältnis zwischen den „schwächlichen Schenkeln“ und dem „stämmigen Nacken“ (z. B. Il. 18, 410-415).
3. Im Gegensatz zur Schilderung von des Gottes armkräftiger Kampfgewandtheit und „schnaubender“ Urgewalt wird er durch die Verbindung mit dem ägyptischen Ptah und den Patäken zum Zwerg, gar zu einem dysproportionierten, achondroplastischen[7] Zwerg (Hdt. 3, 37, 2). Eine seltene Darstellung zeigt den winzigen, hier allerdings wohlproportionierten Künstler- und Handwerkergott, kurz bevor er seine Mutter Hera von dem magischen Thronsessel befreit, den er als kleine Rache für ihre Lieblosigkeit konstruiert hatte[8]. Ist Hephaistos demnach ein hinkender Krüppelzwerg?
Nach einer alten Begründung für die Lahmheit des göttlichen Kunsthandwerkers falle das Handwerk, das einem Helden nicht anstehe, den Krüppeln zu – eine wenig befriedigende Erklärung[9].
4. Weitere Hypothesen verbinden Hephaistos mit den Schmiedegöttern und- Heroen anderer Zeiten und Kulturkreise[10], als man Sehnen gewaltsam durchtrennte, um geschickte Handwerker am Ort zu festzuhalten.
Ist es denkbar, dass man den Gott der Schmiede absichtlich verstümmelte?
Auch Daidalos, nach der Genealogie ein Enkel des attischen Urkönigs Erechtheus, also ein Urenkel des Hephaistos[11], war ein begabter Zimmermann und Künstler, den König Minos auf Kreta festhielt. Von dort gelingt ihm die Flucht bekanntlich mittels seiner künstlichen, mit Wachs befestigten Flügel, während sein Sohn Ikarus der Sonne zu nahe kommt und sich zu Tode stürzt. Der Flug führt den Künstler unter anderem nach Sizilien, wo er seinen göttlichen Ahnherrn, Hephaistos/Vulcanus, trifft. Dieser ist besonders eng mit dem Feuer speienden Ätna und den liparischen Inseln verbunden. Überhaupt lasse der Himmelssturz des Gottes nach Roscher nur eine Deutung zu[12], nämlich das Herabkommen des Feuers im Blitz (Serv. Aen. 8, 414). Pindar bezieht die Ausbrüche des Ätna auf Hephaistos (Pind. P. 1, 25). Die mythische Doppelaxt ist ebenfalls ein Bindeglied zwischen dem göttlichen Ahnherrn und seinem Urenkel Daidalos. In den Darstellungen des Hephaistos als Helfer bei der Athenageburt spielt die Doppelaxt eine große Rolle. Niemals ist in diesem Zusammenhang eine Behinderung zu erkennen.
Abb. 4: Hephaistos mit Doppelaxt bei der Athenageburt, etwa 570 v. Chr.
Athena wird aus dem Kopf ihres Vaters Zeus geboren. Sie hatte ihm heftige Schmerzen bereitet, bis Hephaistos die langwierige Entbindung durch einen Hieb mit der Doppelaxt beendet. In voller Kleidung und Rüstung entspringt die Jungfrau dem göttlichen Haupt (Pind. O. 7, 35-38; Hom h. 28, 4-5). Als sich Hephaistos in die unnahbare Göttin verliebt, ist seine Verfolgung natürlich zum Scheitern verurteilt (Paus. 1, 14, 6. Hyg. Fab. 166); aber sein Samen fällt auf die Erde und befruchtet sie. So bringt Gaia/Ge den schlangenfüßigen Erichthonios hervor, den autochthonen Stammvater der Athener (Apollod. 3, 14, 6)[13]. Gaia übergibt ihn der Athena, die hier als Kourotrophos auftritt, zur Aufzucht[14]. In Attika sind die Göttin und Hephaistos, verhinderte Partner in Punkto Liebe, gleichwohl Kultgefährten (Paus. 1, 14, 6). Sie werden im Tempel auf der Athener Agora gemeinsam verehrt. Athena ist ja nicht nur die Göttin der Weisheit und des Krieges, sondern wie Hephaistos auch Schützerin des Handwerks.
5. In jüngerer Zeit versuchen manche Autoren das Hinken des Schmiedegottes naturwissenschaftlich zu erklären. Bis in das 3. Jahrtausend v. Chr. arbeiteten die Schmiede nämlich mit Arsenbronzen. Beim Schmelzen von Arsenerzen mit Kupfer bildet sich schon bei 200 Grad der giftige Hüttenrauch, As2O3, der vor allem zu Lähmungen der Beine führt[15].
Liegt hier gar eine arbeitsmedizinische Anamnese vor, und Hephaistos leidet an den Folgen einer Berufskrankheit? Auch zu dieser Hypothese schweigen die antiken Schriften. Nach Meinung von Schrade hätte Homer wenigstens ein Wort darüber gesagt, wenn er geglaubt hätte, dass die schwachen Beine eine Folge seiner Arbeit seien[16]. Einzelne bildliche Darstellungen sind dazu angetan, die Lähmungshypothese zu stützen. Der berühmte Fronçoiskrater in Florenz zeigt Hephaistos rittlings auf einem Maultier sitzend. Beide Füße sind regelrecht geformt, doch ist der linke nach vorn, der rechte nach hinten gerichtet[17] – ein Zeichen fehlender Muskelkontrolle? Auf einer schwarzfigurigen Amphora in London ist der Gott mit auffallend schlaff herunterhängenden Füßen dargestellt[18], sodass ein Lähmungsspitzfuß denkbar wäre[19]. Trotzdem sind diese naturwissenschaftlichen Erklärungsversuche nicht ganz überzeugend. Vor allem stellt sich die Frage, warum ein berühmter, erfahrener Kunsthandwerker wie Hephaistos, wenn er denn gelähmt ist, nicht ein Paar Peroneusschienen (Fußheberschienen) konstruiert, er, der sich zu seiner Unterstützung sogar künstliche goldene Mädchen geschaffen hat?„ [..] nahm das Zepter, das dicke.
Humpelnd ging er zur Tür hinaus, und goldene Mägde
Stützten den Herrn von unten; sie glichen lebendigen Mädchen.
Denn sie haben Verstand im Innern und haben auch Stimme
Und auch Kraft und lernten von ewigen Göttern die Werke.
Und sie keuchten als Stütze des Herrn; der humpelte aber
Hin, wo Thetis war [..]“.(Il. 18, 416-423)
Auf all die anderen wunderbaren Erfindungen und Erzeugnisse des göttlichen Schmiedes kann hier nicht eingegangen werden; von dem kostbaren, magischen Thron für seine Mutter Hera war schon die Rede. Wir wollen vielmehr, nach einem Exkurs, noch eine weitere Hypothese anfügen.
6. Hephaistos ist eine mythische Gestalt. Schon deshalb können die rein naturwissenschaftlichen Erklärungen für seine Behinderung, wie Arsenvergiftung, nicht befriedigen. Die als Lähmungspitzfuß interpretierbaren Darstellungen sind selten und zweifelhaft. Archaische Vasenmaler geben den Gott mit gekrümmten Füßen wieder. Das passt nicht zu einer Parese, sondern eher zum Klumpfuß. In der klassischen Zeit wird die Gehbehinderung nur mehr angedeutet, schließlich verschwindet sie ganz.
Mythologische Begründungen liegen näher.
Wir haben es mit einem besonderen, einem fremden Gott zu tun. Sein Kult ist durch Linear B in Knossos für die kretisch- mykenische Zeit bezeugt; der Name des Hephaistos aber lässt sich aus dem Griechischen bisher nicht deuten. Möglicherweise geht er auf die Sprache seines ureigenen Volkes, der Sintier auf Lemnos (vielleicht waren es Thraker?) zurück[20], die ihn einst vor den Folgen seines Sturzes bewahrten.
Als vorgriechische, besonders im ägäisch-anatolischen Grenzraum verehrte Gottheit ist er gemäß der Überlieferung mit dem Künstlergott Koschar von Ugarit[21] und dem ägyptischen Ptah von Memphis[22] verwandt. Im 7. Jh. v. Chr. kamen ionische und karische Söldner nach Ägypten und begannen, neben ihren eigenen auch die lokalen Götter zu verehren. Möglicherweise brachten sie ein Bild des Hephaistos mit, das diesen „noch ganz ursprünglich – als Krüppelzwerg – vorstellt“[23].
Herodot 3, 37, 2-3 berichtet, es sei „die Kultstatue des Hephaistos im Heiligtum von Memphis [..] nämlich sehr ähnlich den phoinikischen Pataikos- Figuren, die von den Phoinikern am Bug ihrer Trieren mitgeführt würden. [..]. Sie sind das Abbild eines zwergenhaften Mannes [..]. Auch die [..] Statuen der Kabiren ähneln dem Hephaistos; man sagt, es seien seine Kinder“[24].
Der Gott empfängt also Kult nicht nur in Attika und Westgriechenland, sondern auch in halb barbarischen Gegenden wie Lemnos, Kleinasien oder Memphis. Er ist ebenso im Olymp zu Hause wie in den Höhlen Feuer speiender Berge. Der Mythos vom Herunterstürzen des Gottes wird auch als das Niederfahren des himmlischen Feuers im Blitz gedeutet. In der Aenaeis ist von Behinderung nicht die Rede, umso mehr aber von der Beziehung des Meisters zum Feuer und dessen wandelbarer Gestalt.
„ [..] früh erhebt sich des Feuers Beherrscher [..] und eilt in die Esse des Schmiedes.
Neben Siziliens Küste und seitlich von Aeolus’ Insel, Lipari,
hebt sich ein Eiland mit steilen, rauchenden Felsen,
Unter ihm eine Höhle, die Aetnakluft der Kyklopen,
[..] Hier ist das Heim des Vulkan, und Vulcano nennt sich die Insel.“
(Verg. Aen. 8, 413-422)Die variantenreichen Darstellungen in Schriften und Kunst der Antike erscheinen als Ausdruck der verschiedenen Aspekte ein und desselben Gottes, dessen liebenswürdigste Charaktereigenschaften noch gar nicht zur Sprache gekommen sind: Gutmütigkeit, Hilfsbereitschaft und die Fähigkeit, andere Götter zum Lachen zu bringen, meist auf seine eigenen Kosten. Hephaistos nämlich ist bekanntlich der Urheber des sog. Homerischen Gelächters, gleich, ob er seine treulose Gemahlin Aphrodite in den Armen des Ares erwischt (Od. 8, 266) oder ob er anstelle der reizenden Hebe und des schönen Ganymed als eine Art Hofnarr den göttlichen Mundschenk spielt[25]:
„ [..] es lächelte drob die weißellbogige Hera,
Lächelnd nahm sie darauf mit der Hand vom Sohne den Becher,
Rechtsum schenkte er nun auch all den anderen Göttern
Süßen Nektar ein, mit der Kanne vom Kessel ihn schöpfend.
Unauslöschliches Lachen entstand bei den seligen Göttern,
Als sie Hephaistos sah’n, der durch die Gemächer umher schnob“.
(Il. 1, 595-600)Ist im hinkenden Hephaistos etwa nichts anderes zu sehen als eine der vielen Erscheinungsformen eines „fremden“ Gottes, der im Olymp ebenso zu Hause ist wie auf Lemnos und in Kleinasien, Ägypten und Sizilien, – nicht zu vergessen in unseren nur halb zivilisierten römischen Provinzen diesseits und jenseits der Alpen?
Bildnachweis:
Für die freundliche Erlaubnis, die folgenden Abbildungen zu reproduzieren, danke ich Frau Prof. Dr. Erika Simon, Würzburg, sehr herzlich.
Abb. 1: Sturz des Hephaistos, Relief aus Ostia, 2. Jh. n. Chr.
Aus: E. Simon, Die Götter der Römer (München 1990) 254 Abb. 331. 332
Abb. 2: Rückführung des Hephaistos, korinthischer Amphoriskos, 600-580 v. Chr.
Aus: E. Simon, Die Götter der Griechen (München 1985) 219 Abb. 204
Abb. 3: Hephaistos und Athena, Ostfries des Parthenon, Athen, um 440 v. Chr.
Aus: E. Simon, Die Götter der Griechen (München 1985) 228 Abb. 217
Abb. 4: Hephaistos mit Doppelaxt bei der Athenageburt, Exaleiptron, um 570 v. Chr. Aus: E. Simon, Die Götter der Griechen (München 1985) 187 Abb. 166
Literatur:
L. Balensifen, Achills verwundbare Ferse, Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts, 111, 1996, 82 Anm. 22
E. Bazopoulou- Kyrkianidou, What makes Hephaestus lame? American Journal of Medical Genetics 72, 1997, 144-155
F. Brommer, Hephaistos. Der Schmiedegott in der antiken Kunst (Mainz 1978)
H.-G. Buchholz, Ugarit, Zypern und Ägäis (Münster 1999)
A. Dierichs, Ein hinkender Gott: Hephaistos, in: dies., Von der Götter Geburt und der Frauen Niederkunft (Mainz 2002) 41-44
M. Grmek – D. Gourevitch, Les pieds d’Héphaistos, in: Les maladies dans l’art antique (Poitiers 1998)
G. Jobba, Mi okozhatta Héphaisztosz sántaságát? Communicationes de historia artis medicinae 117-120, 1987, 137-140
L. Malten, Hephaistos, Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts 27, 1912, 232-264
S. Morenz, Ptah- Hephaistos, der Zwerg. Beobachtungen zur Frage der Interpretatio Graeca in der Ägyptischen Religion, in: Festschrift für Friedrich Zucker zum 70. Geburtstage (Berlin 1954) 275-290
A. Mozolics, Hephaistos sántasága. Communicationes de historia artis medicinae 78-79, 1976, 139-148
M. Reitz, Hautkrebs bei alten Hochkulturen, in E. G. Jung (Hrsg.), Kleine Kulturgeschichte der Haut (Darmstadt 2007)
E. Rosner, Die Lahmheit des Hephaistos, Forschungen und Fortschritte 29, 1955, 362f.
W. H. Roscher, Hephaistos. Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen Mythologie I 2, 1965, 2050. 2066
K. Schefold, Die Urkönige, Perseus, Bellerophon, Herakles und Theseus in der klassischen und hellenistischen Kunst (München 1988)
H. Schrade, Der homerische Hephaistos, Gymnasium, 57, 1950, 38-55 und 94-112
E. Simon, Die Götter der Griechen (München 1985)
E. Simon, Die Götter der Römer (München 1990)
E. Simon, Daidalos, in: Althellenische Technologie und Technik von der prähistorischen bis zur hellenistischen Zeit mit Schwerpunkt auf der prähistorischen Epoche (Ohlstadt/Obb. 2003) 195-209
A. D. Trendall, Rotfigurige Vasen aus Unteritalien und Sizilien (Mainz 1989)
J. Wiesner, Olympos. Götter, Mythen und Stätten von Hellas (Nieder-Ramstadt/Darmstadt 1960) 51-54
J. Wiesner, Der Künstlergott Hephaistos und seine außergriechischen Beziehungen in kretisch-mykenischer Zeit, Archäologischer Anzeiger 1968, 167-173
[1] bei der Rückführung z. B. Caeretaner Hydria, Wien, ca. 530-500 v. Chr., Brommer 1978, 203 Taf. 11, 2 sowie Taf. 11, 1 und 3; Hephaistos auf gekrümmten Füßen stehend, etruskische Version als Sethlans, LIMC IV (1988) 657 Nr. 18 a Taf. 405 s. v. Hephaistos/ Sethlans (I. Krauskopf).
[2] s. Kelchkrater c. 460-450 v. Chr., LIMC IV (1988) 641 Abb. 149 Taf. 396 s. v. Hephaistos (A. Hermary).
[3] s. Bazopoulou- Kyrkianidou 1997, 144-155.
[4] Wiesner 1960, 52.
[5] Roscher 1965, 2050.
[6] Schrade 1950, 108-109. Eine weitere Sage überliefere, dass Hephaistos hinke, weil er im Krieg mit seinem Pferd gestürzt sei, s. Morenz 1954, 284 und Anm. 66.
[7] Morenz 1954, 282.
[8] Apulische Amphora, ca. 320 v. Chr., Trendall 1989, 121 Abb. 264.
[9] Malten 1912, 256.
[10] Buchholz 1999, 210 und Anm. 638-639. Hier ist z. B. an die germanische Völundr- Wielandsage zu denken, s. Malten 1912, 259. Verbindung zur Gestalt des hinkenden Teufels in der ungarischen Mythologie: Jobba 1987, 137-140.
[11] Simon 2003, 199-206, bes. 200 Abb. 4; Schefold 1988, 59.
[12] Roscher 1965, 2050.
[13] Für mündliche Informationen hierzu danke ich H.-G. Buchholz und E. Simon. Ferner Roscher 1965, 2064.
[14] Stamnos des Hermonax, ca. 460 v. Chr., Simon 1985, 195 Abb. 178.
[15] Buchholz 1999, 210; Mozsolics 1976, 139-148; Reitz 2007, 78-79 und Abb. 1; Rosner 1955, 362-363; Simon 1985, 213 Anm. 5; Wiesner 1960, 52-53.
[16] Schrade 1950, 109. Ebenfalls aus heutiger Sicht wurde eine frühkindliche Poliomyelitis erwogen, Grmek – Gourevitch 1998, 285.
[17] Klitiaskrater, ca. 560 v. Chr., Simon 1985, 219 Abb. 203.
[18] Balensifen 1996, 82, Anm. 22; LIMC IV (1988) 642 Nr. 157 d Taf. 397 s. v. Hephaistos (A. Hermary).
[19] Der Gott ist zwar ikonographisch an Dionysos angeglichen, aber durch die Doppelaxt eindeutig als Hephaistos ausgewiesen.
[20] Simon 1985, 215.
[21] Wiesner 1968, 170.
[22] Wiesner 1960, 51.
[23] Morenz 1954, 285.
[24] Dazu auch Grmek – Gourevitch 1998, 283-284.
[25] Simon 1985, 214.
-
Ignaz Fülöp Semmelweis ist am 1. Juli 1818 in Buda geboren.
Die Familie stammte aus Szikra/Sieggraben im Burgenland, wo sie als Winzer tätig waren. Der Vater betrieb einen Gewürz- und Kolonialwarenhandel im alten Budaer Stadtteil Tabán, am Fuß der Burg. Sie waren angesehene, wohlsituierte Bürger.
Bild 1: Geburtshaus in der heutigen Apród-utca, unten Geschäft, oben Wohnung
Nach zwei Jahren Philosophiestudium an der Pester Universität geht Ignaz Semmelweis 1837 für ein Jahr zum Jurastudium nach Wien. Dann beginnt er das Studium der Medizin in Wien und Pest. 1844 wird er in Wien mit dem Thema „Tractatus de vita plantarum“ promoviert. Er absolviert einen Lehrgang in Geburtshilfe und wird Aspirant, ohne reguläre Stelle und ohne Salair, bei Prof. Klein an der Geburtshilflichen Klinik. 1846 ist er provisorischer Assistent bei Klein.
Unter L. J. Boër als Leiter der Wiener Geburtsklinik hatte die Todesrate der Gebärenden und Wöchnerinnen 0,84% betragen. Die Hebammen übten nur an Phantomen. Semmelweis wird bald klar, dass Boër spontan, unausgesprochen, das Prinzip der Non-Infektion anwandte.
Nach dessen Amtsenthebung 1822 – als eines Mannes „gegen den Zeitgeist“ – folgt ihm sein am wenigsten begabter Schüler Johann Klein im Amt nach. Infolge der modernen pathologischen Anatomie, die zum vermehrten Üben an Leichen führt, steigt die postpartale Mortalität auf 7,45%.
1840 wird die Klinik geteilt. In der 1. Abteilung, der Ausbildungsstätte der Studenten (Prof. Klein), wird immer häufiger seziert. Die 2. Abteilung (Dr. Bartsch) bildet Hebammen aus, die seltener sezieren. 1841-1846 sterben in der 1. Abt. 9,92% der jungen Mütter, in der 2. Abt. nur 3,38%. Zu dieser Zeit hält man das Puerperalfieber für eine Epidemie und führt sie auf atmosphärische, kosmische oder tellurische Kräfte zurück.
Semmelweis sammelt Daten. Er bemerkt, dass in Paris an der Maternité-Klinik, wo nur Hebammen ausgebildet werden, die aber regelmäßig sezieren, die Sterblichkeit ebenso hoch ist wie an der Ärzteklinik, und er beobachtet in Wien, dass Frauen, die zu Hause oder gar auf der Straße entbinden, weniger häufig erkranken als in der Klinik.
Von 1844-1846 ist Semmelweis zuerst Aspirant, dann Assistent an der von Klein geleiteten Geburtsklinik. Es belastet ihn, dass während dieser Zeit die Zahl der an Kindbettfieber sterbenden Frauen sogar bis auf 15-18% ansteigt. Schuld daran ist, wie er wenig später mit Entsetzen erkennt, seine eigene forcierte Sektionstätigkeit, die ihn ja eigentlich zu der Ursache dieser verheerenden Sterblichkeit hatte führen sollen.
1847 erreicht die Mortalität sogar 18,27%. Wie ein Blitzschlag trifft ihn fast gleichzeitig der Tod seines Freundes Kolletschka, Professor der Gerichtsmedizin, der in Folge einer Fingerverletzung während einer Sektionsübung an einer Sepsis stirbt.
Semmelweis vermutet die Zusammenhänge und schließt als Ursache der Septikaemie auf zersetzte organische Stoffe, die zum Resorptionsfieber führen.
Zwei Monate später, im Mai 1847, beginnt er vor jeder Untersuchung einer Gebärenden oder Wöchnerin seine Hände mit Chlorina liquida, später mit Chlorkalk, zu waschen. Zu diesen Waschungen hält er auch alle seine Schüler an. Zwei Augenzeugen, der Engländer Dr. Routh und der Ungar Lajos Markusovszky, berichten darüber. Schon im Juni sinkt die Todesrate der Mütter im Wiener Gebärhaus auf 2,23%. Es ist vor allem die Statistik, mit deren Hilfe Semmelweis der Krankheit beikommt.
Leider publiziert er seine Erkenntnisse nicht. Zwar hält er 1850 vor der Wiener Gesellschaft der Ärzte drei Vorträge, im Übrigen aber verbreitet sich die Kunde nur durch seine Schüler, seine Korrespondenz und durch die nach Wien kommenden Gastärzte. Der Dermatologe Hebra und der Internist Skoda, der 1849 einen Vortrag über die Semmelweis`sche Entdeckung hält, sind für ihn tätig. Dagegen reagieren die in ihrer Ehre gekränkten Geburtshelfer erbost und beleidigt. Zum Teil führen sie sogar insgeheim die Prophylaxe ein, während sie Semmelweis offen bekämpfen. Man wirft ihm Ungehorsam und Pflichtvergessenheit vor. Unter den positiven Stimmen ist die des Kieler Geburtshelfers G. A. Michaelis. Diesem wird die Erkenntnis seiner eigenen Verantwortung für den Tod so vieler junger Frauen, darunter den seiner Cousine, derart unerträglich, dass er Selbstmord begeht.
1850 übersiedelt Semmelweis, kaum dass er unter anderem auf Betreiben von Skoda die Ernennung zum Wiener Dozenten erhalten hat, nach Pest.
Inzwischen besteht die Welt nicht ausschließlich aus Geburtshilfe und ihren tragischen Folgen. In der Revolution von 1848 hat Semmelweis entgegen anderslautenden, auf unsicheren Quellen beruhenden Behauptungen, keine besondere Rolle gespielt. Hätte er sich politisch fortschrittlich engagiert, so wäre ihm von seinen Feinden Klein und Rosas mit Sicherheit ein Strick daraus gedreht worden. Seit Mai 1851 ist er als Primararzt am Pester St.-Rochus-Spital tätig.
Bild 2: St. Rókus-Kórház
Das Lehramt der theoretischen und praktischen Geburtshilfe an der Universität von Pest, das ihm nun angetragen wird, ist an die Beherrschung der ungarischen Sprache und an sein nachweislich politisch „günstiges“ Verhalten gebunden. Kaiser Franz Joseph bestätigt 1855 seine Berufung zum Universitätsprofessor.
Erst 11 Jahre nach seiner epochemachenden Entdeckung, 1858, erscheint endlich ein Artikel aus der Feder von Semmelweis in der ärztlichen Wochenzeitung/Orvosi Hetilap: „A gyermekágyi láz kóroktana“ (Ätiologie). Dann folgt in deutscher Sprache seine grundlegende Schrift: „Die Aetiologie, der Begriff und die Prophylaxis des Kindbettfiebers“ (Pest, Wien und Leipzig 1861). Im Vorwort heißt es:
„Vermöge meines Naturells jeder Polemik abgeneigt, Beweis dessen ich auf so zahlreiche Angriffe nicht geantwortet, glaubte ich es der Zeit überlassen zu können, der Wahrheit eine Bahn zu brechen [..]. Zu dieser Abneigung gegen jede Polemik kommt noch hinzu eine mir angeborne Abneigung gegen alles, was schreiben heißt. [..] Ich muss [..] nochmals vor die Öffentlichkeit treten, nachdem sich das Schweigen so schlecht bewährt [..] finde ich Trost in dem Bewusstsein, nur in meiner Überzeugung Gegründetes aufgestellt zu haben“.
Trotz dieser Berufung auf sein pazifistisches Naturell wird er jetzt selbst polemisch. „Die überaus größte Anzahl von medizinischen Hörsälen wiederhallt noch immer [..] von Philippiken gegen meine Lehre [..] und es ist nicht abzusehen, wann der letzte Dorfchirurg und die letzte Dorfhebamme das letzte Mal infizieren werden.“
Jetzt sind die Kollegen erst richtig erbost und nicht bereit, dem Befürworter der aseptischen Methode öffentlich zuzustimmen. Eher sollten die Mütter zugrunde gehen, bevor das Ansehen der Professoren beschädigt werde.
In seinem 1862 „an sämtliche Professoren der Geburtshilfe“ gerichteten Offenen Brief, setzt Semmelweis noch gehörig eins drauf, attackiert seine Kontrahenten namentlich und beschuldigt sie expressis verbis des Mordens.
Die Resultate seiner Prophylaxe sind durchgehend sehr eindrucksvoll. Seit 1859 liegt die Zahl der an Kindbettfieber Verstorbenen in Pest unter 1%. Bereits 1862 erlässt der Stadthalterrat in Ungarn für sämtliche Munizipalbehörden und die medizinische Fakultät eine Anordnung über die Durchführung der Asepsis nach den von Semmelweis vorgeschlagenen Maßregeln. Dieser findet nun aber auch für seine Anhänger kein gutes Wort mehr und greift 1863 die Ablehner seiner Lehre in fünf Nummern des „Orvosi Hetilap“ heftig an.
1865 lockt man ihn auf einer Reise, die angeblich zu einem Erholungsaufenthalt weiter nach Gräfenberg führen soll, in die Landesirrenanstalt Wien. Dort endet sein Leben auf Grund einer Sepsis am 13. August 1865.
Mehr als 100 Jahre später, 1977, erkämpft der in Frankfurt am Main lebende Frauenarzt Dr. Georg Silló-Seidl die Herausgabe der im Psychiatrischen Krankenhaus der Stadt Wien archivierten Krankengeschichte und übergibt sie dem Semmelweis-Museum für Medizingeschichte in Budapest.
Die Anamnese stammt noch von Prof. Bókai in Pest. Aus ihr geht hervor, dass der vorher geordnet und logisch denkende, allerdings in Sachen Kindbettfieber kompromisslose Mann seit einigen Jahren zeitweise von einer unerklärlichen Schlafsucht befallen sei. In den letzten fünf Wochen bemerke man eine zunehmende Wesensveränderung. Er vernachlässige sein Äußeres, mache obszöne Bemerkungen, sei verschwenderisch, unruhig und kritiklos. Er schwitze, sei unmäßig im Essen und Trinken und unzuverlässig im Hinblick auf seine Pflichten.
Bei der Aufnahme zeige sich eine von den Pester Chirurgen nicht beschriebene dunkel blaurote Stelle am rechten Mittelfinger. Als Semmelweis die vergitterten Fenster bemerke und am Fortgehen gehindert werde, fange er an zu toben, sodass ihn sechs Wärter kaum bändigen können. Sie legen ihm eine Zwangsjacke an und bringen ihn in die Dunkelkammer.
Am nächsten Tag fallen gesteigerte Unruhe, Sprach- und Gangstörung sowie eine hohe Pulsfrequenz auf. Obwohl sich die Rötung und Schwellung des Fingers über den ganzen Handrücken ausgedehnt haben, äußere er keine Schmerzen. Es folgen Gangrän, Osteomyelitis, Sepsis, geistige Verwirrung und schließlich der Tod. Über die Entstehung der Fingerverletzung wird spekuliert. Die Wahrheit wisse niemand.
István Benedek: [..] “és az akkori brutális ápolási ‚módszerek‘- től szenvedett sérülésből kialakult szeptikus állapot vezetett korai halálához“ [..].
Bei der Autopsie bestätige sich als Krankheitsursache eine durch Lues bedingte Paralyse. Darüber habe man aus falsch verstandener Diskretion mehr als 100 Jahre geschwiegen. Noch 1978 lehnt Silló-Seidl, der sich so sehr um die Beschaffung der Semmelweis‘ schen Krankengeschichte verdient gemacht hatte, diese Diagnose ab.
Auch in Ungarn herrscht 25 Jahre lang tiefes Schweigen. Die Familie magyarisiert 1879 ihren Namen in Szemerényi, was sie nach dem Einsetzen des Semmelweis-Kultes gern rückgängig gemacht hätte. Dies gelang jedoch nur den Nachkommen der Tochter Antonia, die seit 1894 den Doppelnamen Lehhoczky-Semmelweis tragen.
1882 hatte der Freiburger Geburtshelfer Alfred Hegar eine ebenso sachliche wie positive Darstellung des Lebens und der Lehre von Ignaz Fülöp Semmelweis gegeben. Dem war 1885 eine grundlegende Biographie in ungarischer Sprache gefolgt.
1891 werden die sterblichen Überreste des nun endlich berühmt gewordenen Sohnes der Stadt nach Budapest überführt. Mit einem Spendenaufruf am 22. April 1894, unter dem Titel Anyák mentője, iniziiert Jenő Rákosi, Chefredakteur des „Budapesti Hírlap“, den später weltweit üblichen Ausdruck „Retter der Mütter“.
1906 wird die von Alajos Stróbl geschaffene Marmorgruppe enthüllt, die Semmelweis zusammen mit einer dankbaren Mutter darstellt. Sie hat heute ihren Platz vor seiner einstigen Wirkungsstätte, dem Rókus-Korház/ St.-Rochus-Spital.
Bild 3: Statue von A. Stróbl
Die Újvilág utca, wo sich die Gebärklinik befunden hatte, heißt jetzt Semmelweis utca. Unter dem Straßennamen trägt ein sprechendes Relief die Inschrift „anyák megmentője“.
Bild 4: Semmelweis-utca, „Retter der Mütter“
Das Jahr 1965 wird, 100 Jahre nach seinem Tod, von der UNESCO zum Semmelweis-Jahr erklärt. In das restaurierte Geburtshaus zieht das Medizinhistorische Museum ein.
Bild 5: Hof des Museums mit einer Mütter-Statue aus dem fortgeschrittenen 20. Jahrhundert
Heute spricht man in der angelsächsischen Literatur vom „Semmelweis-Reflex“, wenn jemand kritiklos eine These oder eine Person ablehnt, die vielleicht nur ihrer Zeit allzu weit voraus ist. Unter der Semmelweis-Doktrin dagegen verstehen wir die Prävention und Non-Infektion durch die Verpflichtung zum Händewaschen mit einem desinfizierenden Mittel, seiner Zeit mit Chlorkalk. Seit 1969 trägt die Budapester Medizinische Universität den Namen von Ignaz Philipp Semmelweis.
Bild 6: Statue im Hof der Gynäkologischen Klinik Budapest
Medizinhistorischer Exkurs:
Vier Jahre vor Semmelweis‘ Einführung der Prävention, 1843, hatte Oliver Wendell Holmes aus Cambridge/Massachusetts einen Vortrag in der Bostoner Ärztevereinigung gehalten, der in demselben Jahr unter dem Titel „The Contagiousness of Puerperal Fever“ gedruckt wurde. Darin heißt es: „The physician and the disease entered, hand in hand, into the chamber of the unsuspecting patient“ , also: Hand in Hand betraten der Arzt und die Krankheit das Zimmer des ahnungslosen Patienten. Er warnte davor, dass ein Arzt, der sich mit Geburtshilfe beschäftigt, jemals an der Obduktion einer an Kindbettfieber verstorbenen Frau teilnehme. Wenn der Arzt aber eine solche Person seziert oder ein Erysipel behandelt habe, müsse er sich gründlich reinigen, die Kleidung wechseln und dürfe mindestens 24 Stunden lang keine Wöchnerin anfassen. Nach dem Krankheitserreger forschte er nicht.
Semmelweis sah die Ursache der Krankheit in einem zersetzten organischen Stoff, der zum Resorptionsfieber führe. Seit 1847 forderte er als Prävention die Non-Infektion und die Chlorwaschungen. Er schreibt in seiner „Ätiologie“ (S. 266): „Da es [..] sicherer ist, den Finger nicht zu verunreinigen, als den verunreinigten wieder zu reinigen, so wende ich mich an sämtliche Regierungen mit der Bitte um die Erlassung eines Gesetzes, welches jedem im Gebärhause Beschäftigten [..] verbietet, sich mit Dingen zu beschäftigen, welche geeignet sind, seine Hände mit zersetzten Stoffen zu verunreinigen.“ Damit fordert er eindeutig die Asepsis. Nach dem Krankheitserreger forschte auch er nicht.
Über die Priorität ist natürlich gestritten worden, doch zeigt sich im Grunde nur, dass diese Erkenntnisse gegen die Mitte des 19. Jahrhunderts förmlich in der Luft lagen. Dasselbe gilt für die Entdeckung der Krankheitserreger (Keime, Germina, Mikroben, Bazillen).
Nachdem schon Varro, ein Zeitgenosse Julius Caesars, in seinem Buch zur Landwirtschaft (1, 12, 2) über die in sumpfigen Gegenden lebenden winzigen Tierchen, die man mit den Augen nicht wahrnehmen kann, die aber schwere Krankheiten verursachen, philosophiert hatte, rissen die zum Teil durchaus erfolgreichen Versuche, Mikroorganismen nachzuweisen, nicht mehr ab. Antoni van Leeuwenhoek gelang 1674 mit einem selbst gebauten Mikroskop der Nachweis von Protozoen und Bakterien. Donné wies 1837 Vibrionen nach, Lucas Schönlein 1839 einen Pilz als Erreger des Favus scutularis. Dann kam Louis Pasteur, 1857, mit der Entdeckung der Milchsäurebakterien. Drei Jahre später gelang es ihm, die Mikroben durch Erhitzen auf 60-90 Grad (das Pasteurisieren!) unschädlich zu machen. Semmelweis dürften die einschlägigen Publikationen bekannt gewesen sein, doch hielt er es mit dem Gießener Chemiker Justus von Liebig, der den Kontakt faulender Stoffe mit gesunden für ausreichend hielt, um Krankheiten zu verursachen, und der die Erklärung des Zerfalls organischer Stoffe durch das Einwirken von Bakterien verspottete. 1863 konnte ein Bazillus als Erreger des Milzbrandes, Anthrax, nachgewiesen werden. All dies ereignete sich noch zu Semmelweis‘ Lebzeiten.
In seinem Todesjahr, 1865, begann sich in Glasgow Joseph Lister mit dem Problem der Wundinfektion zu beschäftigen. Die Verwendung der Karbolsäure leitete die antiseptische Chirurgie ein. Als Ursache der Infektion betrachtete Lister die von Louis Pasteur so genannten lebenden Krankheitserreger, die Keime. Ebenfalls 1865 erkannte in Gießen der 20-jährige, bei Charkow/Charkiw-Ukraine geborene Ilja Metschnikow die Bedeutung der „Fresszellen“ für die Vernichtung von Krankheitserregern. 1908 erhielt er für seine Phagozytentheorie den Nobelpreis, zusammen mit Paul Ehrlich.
Robert Koch wurde mit der Kultivierung des Bazillus anthracis 1876 und der Entdeckung des Mycobakterium Tuberculosis 1882 zum Begründer der modernen Bakteriologie und Mikrobiologie.
Niemals aber ist, wie István Benedek bereits in den 1980er Jahren schrieb, die Semmelweis-Doktrin so aktuell gewesen wie heute, wo sich vor allem in der westlichen Welt die nosokomialen Infektionen beinahe unbegrenzt vermehren.
Epilog:
Am 05. April 2009 wurde ich durch die Verleihung der Semmelweis-Plakette und mit einer Ehrenurkunde der Internationalen Semmelweisgesellschaft ausgezeichnet.
Bild 7: Plakette pro arte medicea Hungariae, Künstlerin: Katalin Gera
„Ärztliche Ethik kennt keine Kompromisse“ ist das Motto dieser Gesellschaft. Ein Satz aus Semmelweis‘ Offenem Brief an Joseph Spaeth steht damit in direktem Zusammenhang: [..] “ein Jeder, der es wagen wird, gefährliche Irrthümer über das Kindbettfieber zu verbreiten, wird an mir einen rührigen Gegner finden“.
Doch – ein Wermutstropfen fällt in den edlen Wein. Wer heutzutage die Semmelweis-Grabstätte auf dem Kerepesi-Friedhof in Budapest besuchen will, ist weitgehend auf sich selbst angewiesen, denn die Wärter wissen nichts von dem doch recht monumentalen Sarkophag, ja sogar der Name Semmelweis ist ihnen fremd! Es zeigt sich also auch hier wieder einmal mehr: der Prophet gilt nichts im eigenen Land!
Bild 8: Semmelweis-Sarkophag
Für ihre tatkräftige Unterstützung bei meinen Recherchen danke ich Prof. Dr. Beatrix Farkas, Dr. László Hodinka, Petúr Krasznai MBA, Dr. Péter Szutrély und Gerold Wiese MSc (Budapest, Keszthely, Münzenberg).
Photos: Petúr Krasznai und Waltrud Wamser-Krasznai
Literatur:
J. Antall, Der Lebensweg von Ignác Semmelweis, in: Aus der Geschichte der Heilkunde Suppl. 13-14 (Budapest 1984) 17-29
I. Benedek, Ignaz PhilippSemmelweis (Wien-Köln-Graz 1983)
Bericht von Lambrecht, Miklós, in: Nagy Ferenc (Hrsg.), Magyarok.
A természettudomány és a technika történetében (Budapest 1992) 465-467 und in: Nagy Ferenc (Hrsg.), Magyar Tudóslexikon Á-tól Zs-ig (Better Kiadó 1997) 719-721 (Zweitabdruck)
Blutiges Handwerk – Klinische Chirurgie. Zur Entwicklung der Chirurgie. Eine Ausstellung des Westfälischen Museumsamtes (Münster 1989/90)
H. S. Robert Glaser – M. Henze, Metschnikow, Phagozyten und Gießen, Gießener Universitätsblätter 38, 2005, 69-74
E. Lesky, Ignaz Philipp Semmelweis und die Wiener medizinische Schule (Wien 1964)
Th. Mildner, De febre puerperale. Eine medizinhistorische Studie um den Hospitalismus im 18. Jahrhundert (Ruhpolding 1962)
Sh. B. Nuland, Ignaz Semmelweis. Arzt und großer Entdecker (München 2006)
H. Schipperges, 5000 Jahre Chirurgie (Stuttgart 1967)
I. Ph. Semmelweis, Die Aetiologie, der Begriff und die Prophylaxis des Kindbettfiebers (Pest, Wien und Leipzig 1861), in: The Sources of Science (New York und London 1966)
I. Ph. Semmelweis, Offener Brief an sämmtliche Professoren der Geburtshilfe (Ofen 1862)
István Száva, Ein Arzt besiegt den Tod (Budapest 1968)
G. Silló-Seidl, Die Wahrheit über Semmelweis. Das Wirken des großen Arzt-Forschers und sein tragischer Tod im Licht neu entdeckter Dokumente (Genf 1978)
Copyright Frau Dr. med. Dr. phil. Waltrud Wamser-KRasznaiD